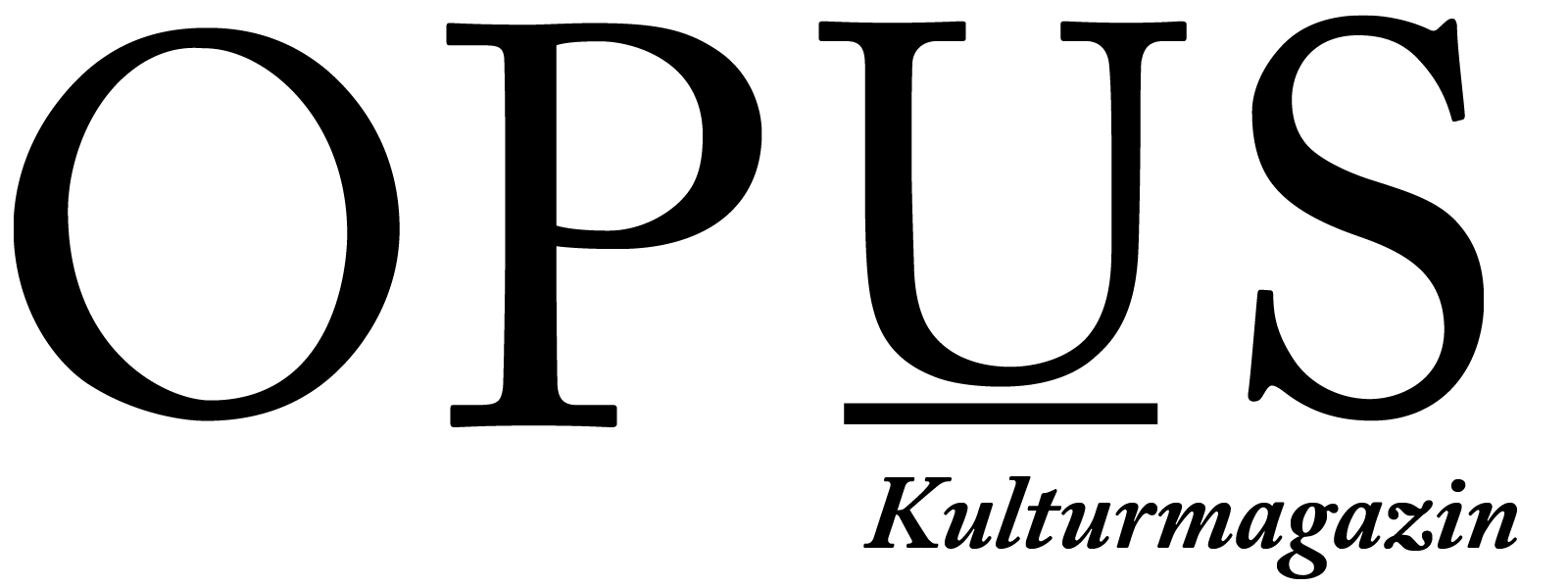Pauliina Linnosaari, Peter Schöne, Judith Braun und Angelos Szamartzis (von links) © Foto: Martin Kaufhold
„Endlich wieder!“ war beim Premierenpublikum zu hören. „Endlich wieder!“, das betonte auch der Intendant Bodo Busse, als er freudig vor der Aufführung an die Rampe trat und dem reduzierten Publikum vielleicht neue Erkenntnisse und Einsichten in Giuseppe Verdis „Troubadour“ versprach. Und dieses Versprechen löste die Inszenierung auf vielfältige Weise ein.
Es gab kein Kampfgetümmel, keine Massenszenen des Chors, keine Liebesumarmungen und überhaupt blieben alle Protagonisten – geschützt in eigenen Bildern, die wie eng geschnittene Zimmer, fast wie Kabinen wirkten – ganz bei sich. Und trotzdem war es keine konzertante Aufführung, denn die Kommunikation und die Handlungsmomente brachte die melodiereiche Musik ein, die inneren Zustände der Beteiligten kamen dadurch nur umso deutlicher heraus. So wurden die Sinne ganz besonders geschärft. Die hohen Räume mit den schrägen Wänden wirkten wie Verstärker der Gesangsstimmen und das machte das Musikerleben noch intensiver, ließen das Timbre der Stimmen noch deutlicher spüren und sogen das Publikum mitten hinein in das Geschehen. Dazu kam, dass das Orchester nur mit gut 15 Musikern besetzt war, mit denen der Generalmusikdirektor Sébastien Rouland die ganze Palette vom kammermusikalischen Klang bis zum fast sinfonischen Eindruck entfalten konnte. Die Partitur wirkte damit erstaunlich transparent, konzentriert auf das Wesentliche und man konnte den musikalischen Ideen fast noch besser folgen, als wenn ein großes Streichergewebe den Klang in die Breite gegossen hätte. Rouland, der auch die Sänger mit höchster Aufmerksamkeit führte, hat diese Oper auch maßgeblich zum Erfolg geführt.
Es geht in dieser Oper um Rache und die Tragödien, die unweigerlich folgen. Die Vorgeschichte: Der alte Graf Luna hatte eine Zigeunerin verbrennen lassen, aus Rache, weil sie angeblich einen seiner beiden Söhne krank gemacht habe. Die Zigeunerin forderte auf dem Weg zum Schafott von ihrer Tochter Rache. Die wollte einen der Söhne Lunas ebenso ins Feuer werfen, doch in ihrer Raserei ergriff sie ihren eigenen Sohn. Den entführten Grafensohn nahm sie statt seiner an. Diese Zigeunertochter Azucena beherrscht das Stück, in der Saarbrücker Inszenierung war sie durchgehend auf der Vorderbühne zu sehen, als Tramp mit Rucksack und Isomatte. Judith Braun war in dieser Rolle vorzüglich, und sie konnte die ganze Palette von Rachegesang bis zur zärtlichen Mutterliebe zum Ausdruck bringen, bewacht vom Bild ihrer Mutter, deren Gesicht lebensgroß auf die Leinwand projiziert wurde. Beide Grafensöhne, der eine als neuer Conte, der andere, Manrico, als Anführer einer Rebellengruppe, lieben später dieselbe Frau, Leonora, die sich im Herzen für Manrico, den Sohn der Zigeunerin entschieden hatte. Den Conte spielt Peter Schöne, auch sängerisch sehr überzeugend, der als eine Art lebendiges Standbild geschminkt und gekleidet war, während der lebendige, emotionale Manrico von Angelos Szamartzis verkörpert wurde, der sängerisch die wohl beste Leistung ablieferte – trotz kleiner Schwächen am Schluss. Es kommt später zum Kampf zwischen beiden, aus politischem und persönlichem Hintergrund, den Kampf um Leonora, die von Pauliina Linnosaari herzzerreißend interpretiert wurde. Erst ganz am Schluss, als Manrico hingerichtet wurde und Leonora Gift genommen hatte, um ihrer Liebe letzten Ausdruck zu geben, gesteht Azucena, dass die beiden Brüder waren.
Das Bühnenbild von Julius Semmelmann ist schlagend. Die Kabinen der Sänger laufen auf der Drehbühne am Zuschauer vorbei, manchmal sind alle beleuchtet, und es wirkt wie ein Kaleidoskop. Später sind die Kabinen in abgedrehter Form die Gefängniszellen. Der aus Japan stammende Regisseur Tomo Sugao hat die Personenführung auf das Nötigste reduziert und damit die Handlung in den Köpfen der Zuschauer entstehen lassen. So konnte man sich ein ums andere Mal in den schönen Klängen Verdis fast verlieren. Der vorzügliche, junge Chor sang aus dem Off, in einem Probensaal und wurde per Lautsprecher auf die Bühne übertragen. Massenszenen deutet Sugao auf einer Unterbühne an, Szenen, die übrigens an Demonstrationszüge der Corona-Gegner erinnerten – hier aber waren alle mit Mundschutz ausgestattet.
Eine schlüssigere Form der Darbietung einer großen Oper unter Hygienevorschriften hätte man sich fast nicht vorstellen können. Es war ein Erlebnis, ein sinnliches, ein emotionales, das man ‚endlich wieder‘ einmal auf der großen Bühne erleben durfte mit raren und umso wertvolleren Einblicken in ein Musiktheater, dessen Arien wie „Lodern zum Himmel sehe ich die Flammen“ die Musikwelt schon immer begeistert haben. Sehr empfehlenswert.
Friedrich Spangemacher