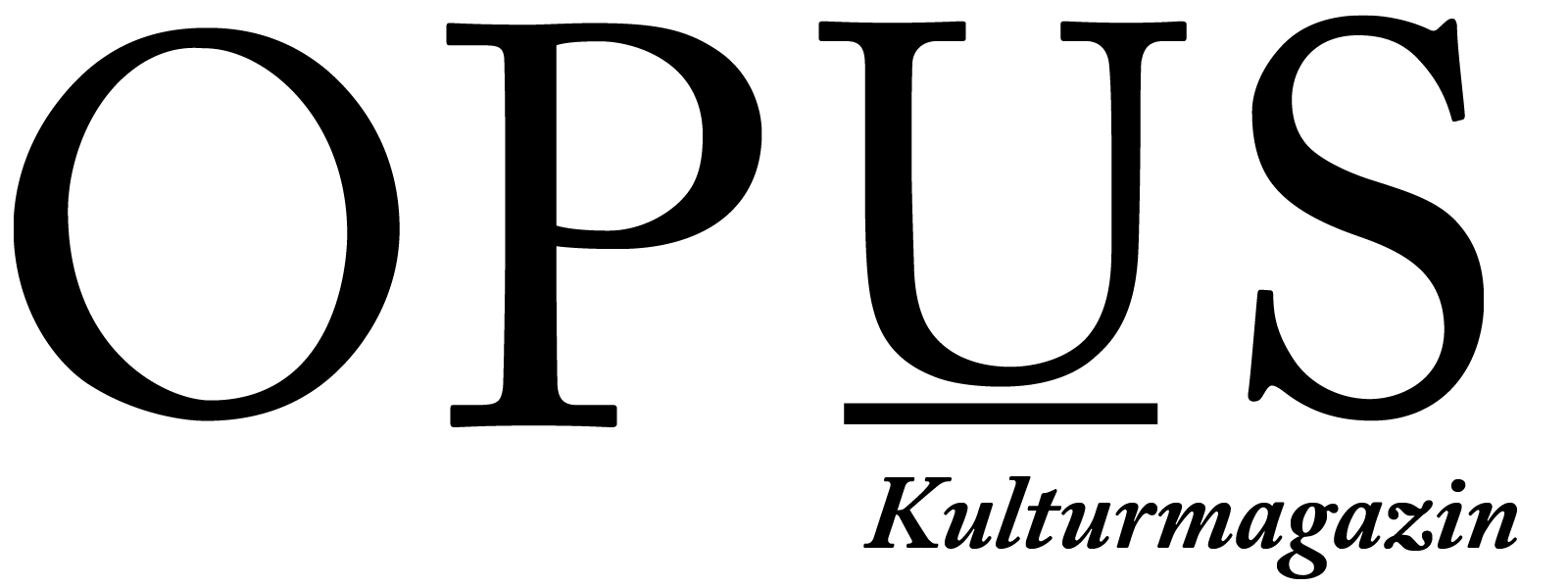Romeo in der Pathologie ©Marco Piecuch
Das Eingangsbild ist stark. Im kalten Licht eines Pathologiesaals liegen die Leichen von Romeo und Julia auf weiß gekachelten Quadern. Dahinter: ihre fassungslosen Eltern. Oben am Saalfenster, dessen Brüstung später als Balkon vor Julias Schlafzimmer dient, steht der Pathologe (Manfred –Paul Hänig) und kündigt die Geschichte des unglücklichen Liebepaars an. Der klinische Raum mit seinen Blöcken (Bühne und Kostüme James Button), die gleichermaßen als Bahre, Bett, Schrank und Hochbeet für jenes Cannabis Kraut dienen, dessen Extrakt Julia einschläfert, gibt der Inszenierung Kontur und die Linie vor. Hier läuft alles auf den Tod hinaus. Eine ideale Exposition also , um die Tragödie zu sezieren und ihren Ursachen auf den Grund zu gehen. Leider beschränkt sich Regisseur Ryan Mc Bryde dann doch darauf, eine ziemlich schlichte Geschichte mit Todesfolge nach Art von West Side Story zu erzählen. Das Ganze geschieht als Rückblende der letzten vier Tage, deren Minuten und Sekunden als digitale Anzeige an der Bühnenwand ablaufen. Obwohl der englische Regisseur recht nah entlang Schlegels poetischer Übersetzung inszeniert, kommt er Shakespeare nicht wirklich nahe. Über die Pathologie dieses selbstzerstörerischen Hasses, der längst Konvention ist und dem die Liebenden zum Opfer fallen, erfährt man wenig. Genauso wenig wie über die Psychologie jener romantischen Vision einer weltentrückten Liebe, deren Protagonisten hier dennoch unausweichlich an der Welt schuldig werden. Mc Bryde begnügt sich damit, gemeinsam mit seinem engagierten Ensemble die Geschichte zu illustrieren, aber er taucht nicht tief. Trotz der durchaus temporeichen Inszenierung und des fabelhaften Lichtdesigns von Ben Cracknell werden einem die gut zwei Stunden, die vier Tage Bühnenzeit umfassen, lang. Der seinerzeit für den Theaterpreis „Faust“ nominierte Brite, der im Frankfurter English Theatre seine Sozialkritik mitreißend rockte und ebenda in Lawrence „Fox“ wunderbare Traumsequenzen schuf, bleibt in Trier als Regisseur erstaunlich blass. Hass gibt es oben wie unten, erfährt der Zuschauer. Das wusste man allerdings längst. Mc Brydes Verona liegt dann auch nicht zwingend an der Etsch. Seine Capulets und Montagues sind keine vornehmen Patrizier. Ihre Familienfehde und ihr Personal kann man mühelos in Duisburg oder Berlin-Neukölln verorten. Gleich eingangs liefern sich die verfeindeten Clans eine Straßenschlacht. Das Fest im Hause Capulet gleicht einer Gothic Disco. Julia Capulets Vater (Klaus-Michael Nix) ist ein kleinbürgerlicher Anzugträger ohne Impulskontrolle, aber mit reichlich nuttiger Frau (Stephanie Theiß), der brüllend seine schreiende Tochter an den Haaren über die Bühne schleift. Dagegen scheint Romeos Vater Cäsar Montague (Michael Hiller) direkt von der Baustelle zu kommen. Romeos Freunde Mercutio (Gideon Rapp) und Benvolio (Paul Behrens) sind zwei prollige Halbstarke, die mit pubertären Sprüchen um die Häuser ziehen. Als allzeit bereite Amme kann Barbara Ullmann ihrem Schützling Julia nichts abschlagen. Die psychologischen Beweggründe solcher Hingabe bleiben freilich im Dunkeln. Ihren stärksten Moment hat Ullmann, wenn sie vor Entsetzen stumm in die Knie geht. Benjamin Schardt gibt als Pater Lorenzo den lebenspraktischen Gemeindepfarrer von nebenan. Als Paris betreibt Martin Geisen seine Werbung um Julia eher geschäftsmäßig. Sterblich verliebt und vom Trennungsschmerz geplagt, macht Robin Jentys als Romeo durch allzu viel Theatralik platt, was dieser „Narr des Glücks“ an Feinnervigen zu bieten hat. Die besten Momente hat der junge Schauspieler, der zum Saisonbeginn einen formidablen jungen Karl Marx abgab, wo er leise und lyrisch ist. Flott aber wenig anrührend wirkt Anna Pilcher als Julia. Zudem hat sie Probleme mit dem Text. Wirkliche Schärfe verleiht seiner Rolle lediglich Dimetrio-Giovanni Rupp. Sein Tybalt ist ein gefährlicher Sachwalter des alten Hasses, der in ihm lauert, und gewalttätig und obszön aus ihm herausbricht. Als respektabler Escalus sorgt Norman Stehr für öffentliche Ordnung. „Dumm gelaufen die Geschichte“, denkt man am Ende, zumal die Versöhnung der Familien ein „düsterer Frieden“ ist, wie Shakespeare Paris in Schlegels Originaltext erkennen lässt. Ergriffenheit mag sich nicht einstellen. Womöglich auch nicht beim Ensemble, das zum Ende des anhaltenden Beifalls zur Freude des Publikums schnell nochmal die Bühne rockt. Übrigens: Vorsorglich hat Mc Bryde in Zeiten von „Me too“ Julias Alter um zwei auf 16 Jahre heraufgesetzt, wie zu lesen war. Amerikanische Shakespeare Rezeption in good old Europe.
Weitere Termine: 30.3., 10.5., 22.5., 18.6.,19.30 Uhr, 7.4.,16 Uhr, 28.4. ,18 Uhr, 28.5.,10Uhr
Eva-Maria Reuther