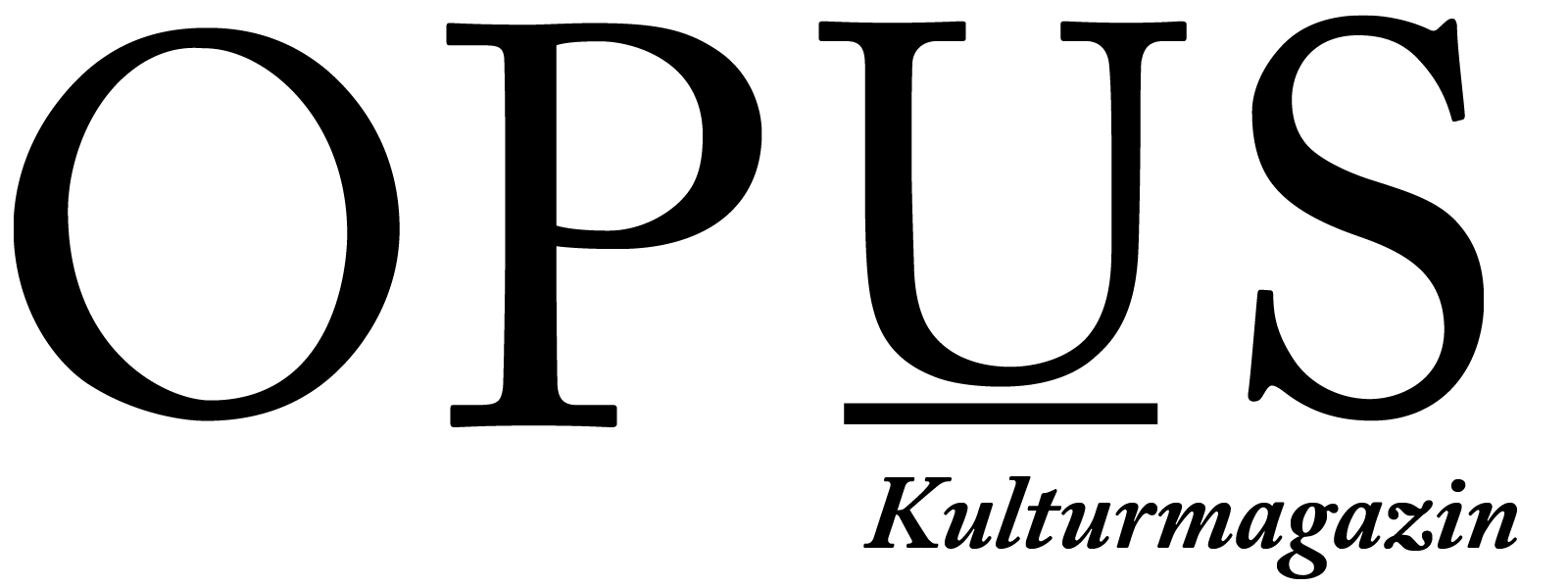Heinrich Heine (Gemälde von Moritz Daniel Oppenheim, 1831 ); The Bridgeman Art Library, Objekt 149505; gemeinfrei aus Wikimedia Commons
Heinrich Heines Gedicht Jetzt wohin?*, das ich zugegebenermaßen erst kürzlich entdeckte, lese ich als eine poetische Metapher für die gegenwärtig um sich greifende Orientierungslosigkeit – aber auch als ironischen Kommentar dazu.
Die ungekrönten, verfluchten Corona-Zeiten belasten uns längst alle, in verschiedenster Hinsicht. Erfreuten sich anfangs manche „Solo-Selbständige“ unter den Künstlern oder Autoren, noch an ihrer „splendid isolation“, in welcher sie sich vermeintlich ohne die übliche Ablenkung durch Termine und gesellschaftliche Verpflichtungen mit voller Konzentration ihrer (Autoren-)Tätigkeit widmen konnten, so herrschen nun auch in den kreativen Köpfen zunehmend Ernüchterung, Sorge und – Orientierungslosigkeit vor.
„Worüber soll ich schreiben, für wen, mit welcher Intention, und wenn ja – warum?“
Für wen komponieren Sie eigentlich? fragte der Musikjournalist Hansjörg Pauli in seinem 1971 erstmals erschienen Büchlein eine Reihe von „Avantgarde“-Komponisten jener Zeit. Damals, vor rund fünfzig Jahren, drehte sich zwar nicht alles aber vieles in der Kunst(-Rezeption) um den Begriff der „gesellschaftlichen Relevanz“. Heute wissen wir, dass Kunst zumindest von der Politik (vor allem in „Corona-Zeiten“) kaum als „systemrelevant“, sondern eher als unterhaltende, dekorative Nebensache – als „schöner Schein“ erachtet wird.
„L’art pour l’art“ wäre in dieser Situation also vielleicht wieder eine angesagte Option, wenn nicht selbst oder sogar gerade der kreative Geist Nahrung bräuchte: soziale Nahrung in Form von Aufmerksamkeit und Anerkennung – neben schönen Worten (des Lobes wie der Kritik) gerne auch als materieller Lohn –, vor allem aber die lebendige Auseinandersetzung mit dem „generalisierten Anderen“. George Herbert Mead, der US-amerikanische Philosoph und Sozialpsychologe (1863-1931) formulierte in seinem Buch „Die Genese des sozialen Selbst“ als einer der Ersten die bahnbrechende (inzwischen längst wissenschaftlich erwiesene) Erkenntnis, dass jeder Mensch den generalisierten Anderen existentiell braucht, um sein (soziales) Selbst überhaupt entwickeln und erkennen zu können.
Glücklicherweise (oder etwa fataler Weise?) sind Künstler und Autoren auch nur Menschen. Längere Zeiten des „social distancing“, wie sie die Pandemie seit rund einem Jahr gebietet, bekommen ihnen also ebenso wenig wie gewöhnlichen Sterblichen. Aber wahrscheinlich bewirken der Mangel an echter (face to face) Kommunikation, an Auftrittsmöglichkeiten, an Konfrontation mit Publikum und Kritik bei der künstlerisch (geistig) produktiven Bevölkerungsgruppe auf Dauer einen noch entscheidenderen Mangel, wie etwa an der nötigen Inspiration, die nämlich keineswegs vom Himmel fällt, sondern sich letzten Endes wie jede menschliche Identität dem Sozialspiegel des „generalisierten Anderen“ verdankt.
Bedenken wir also, dass „Corona“ neben den vielfach diskutierten und publizierten politischen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen Aspekten möglicherweise auch eine noch weitgehend undefinierte geistige Orientierungslosigkeit zeitigen wird – wobei in unserer globalisierten Welt auch die Frage nach geografischen Alternativen sinnlos geworden ist. Überraschenderweise war sie offenbar auch schon sinnlos für Heinrich Heine, als er die „Lamentatio“ (Klagelied) Jetzt wohin 1851 in seinem „Romanzero“ veröffentlichte.
Wolfgang Korb
*Heinrich Heine
Jetzt wohin?
Jetzt wohin? Der dumme Fuß
Will mich gern nach Deutschland tragen;
Doch es schüttelt klug das Haupt
Mein Verstand und scheint zu sagen:
Zwar beendigt ist der Krieg,
Doch die Kriegsgerichte blieben,
Und es heißt, du habest einst
Viel Erschießliches geschrieben.‘
Das ist wahr, unangenehm
Wär mir das Erschossenwerden;
Bin kein Held, es fehlen mir
Die pathetischen Gebärden.
Gern würd ich nach England gehn,
Wären dort nicht Kohlendämpfe
Und Engländer – schon ihr Duft
Gibt Erbrechen mir und Krämpfe.
Manchmal kommt mir in den Sinn,
Nach Amerika zu segeln,
Nach dem großen Freiheitstall,
Der bewohnt von Gleichheitsflegeln –
Doch es ängstet mich ein Land,
Wo die Menschen Tabak käuen,
Wo sie ohne König kegeln,
Wo sie ohne Spucknapf speien.
Rußland, dieses schöne Reich,
Würde mir vielleicht behagen,
Doch im Winter könnte ich
Dort die Knute nicht ertragen.
Traurig schau ich in die Höh‘,
Wo viel tausend Sterne nicken –
Aber meinen eignen Stern
Kann ich nirgens dort erblicken.
Hat im güldnen Labyrinth
Sich vielleicht verirrt am Himmel,
Wie ich selber mich verirrt
In dem irdischen Getümmel.