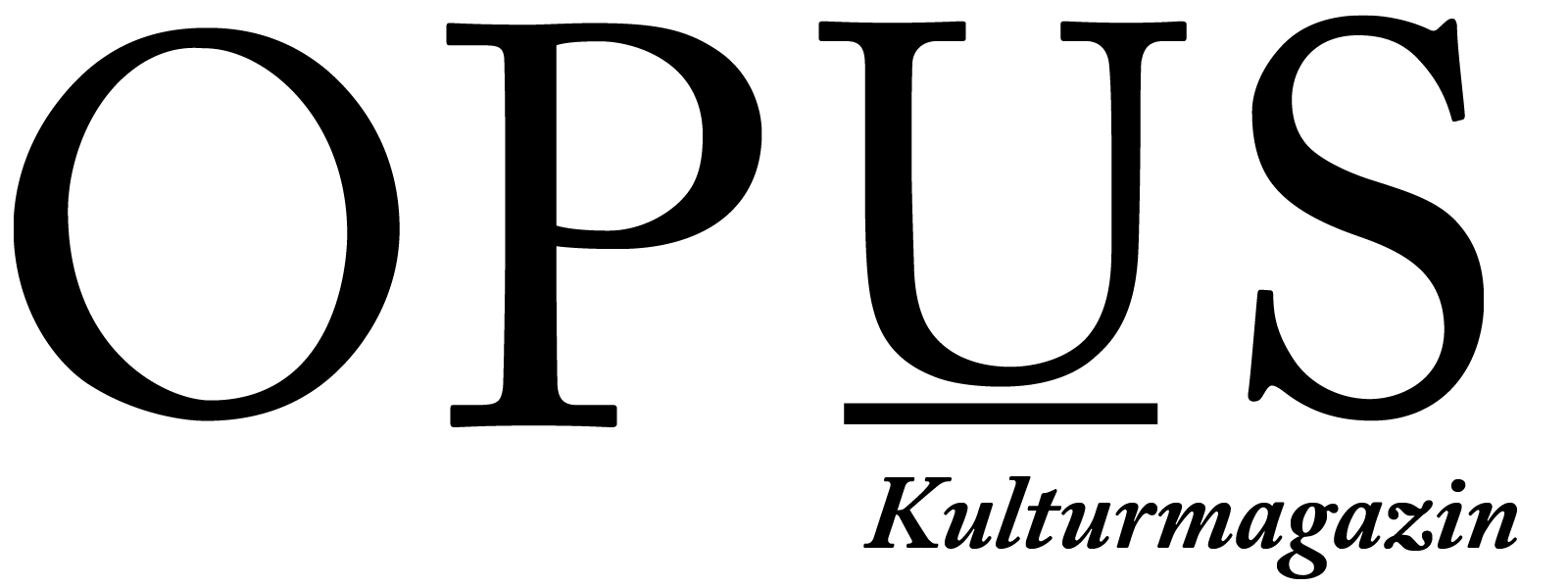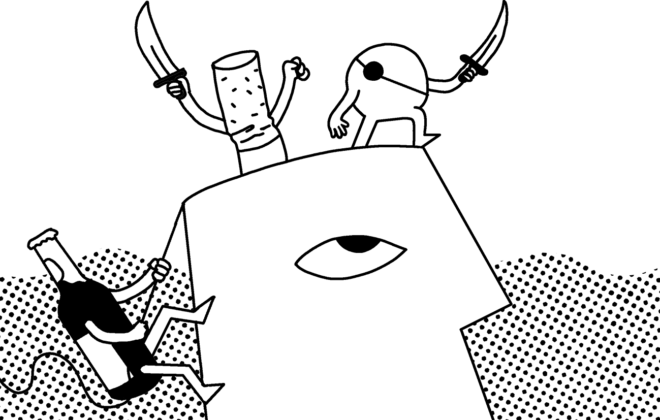
Die Sucht kapert das Gehirn und den Menschen © Besnik Spahijaj
„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ von Kai Herrmann und Horst Rieck ist bis heute eines der erfolgreichsten deutschen Sachbücher. Zum Zeitpunkt seines Erscheinens gab der Text den wohl ersten Einblick in die Drogenszene der 1970er Jahre. Im Zentrum steht die damals jugendliche Christiane Felschenirow (1962) und ihr Kampf mit Heroinabhängigkeit. Das Buch machte die damals 16-Jährige in wenigen Wochen über Deutschland hinaus berühmt und warf ein Schlaglicht auf den sozialen Kontext und die Folgen einer Opiatabhängigkeit.
Zu der Zeit als die junge Felschenirow erstmals Heroin schnupfte — bei einem David Bowie-Konzert im April 1976 — galt Suchtverhalten oft noch als Folge eines charakterlichen Makels, als Mangel an Selbstkontrolle. Erst während der vergangen 20 Jahre hat die Hirnforschung ein Verständnis von den Mechanismen erarbeitet, die bei der Ausbildung einer Sucht im Gehirn eines Menschen ablaufen. Heute ist klar: eine Sucht ist eine Erkrankung des Gehirns, die nicht nur von Drogen ausgelöst werden kann, sondern auch von geschickt gewählter Manipulation des Verhaltens.
Alle süchtig machenden Drogen, von Nicotin und Alkohol über Amphetamine, Kokain, Crack bis zu Crystal Meth und Heroin haben eines gemeinsam: sie verursachen im Gehirn die massive Ausschüttung des Botenstoffes Dopamin, insbesondere in den sogenannten Basalganglien. Diese Gruppen von Hirnzentren tief im Gehirn (etwa auf der Höhe der Ohren) bilden eine Art Kommandozentrum, das emotionale und Sinnesinformationen integriert und unser Handeln von Moment zu Moment steuert.
Sucht im Gehirn
Zielgerichtete bewusste Handlungen werden zwar von der Großhirnrinde geplant. Doch vor ihrer Umsetzung müssen sie von den Basalganglien gewissermaßen freigegeben werden. Erst sie entscheiden, ob eine Handlung — etwa der Griff zur Zigarette oder auch zur Heroinspritze —ausgeführt wird oder nicht. Jedes Bewegungsprogramm aktiviert die Basalganglien entlang zweier paralleler „Pfade” (Ketten von Nervenzellen), die wieder in der Hirnrinde münden. Einer der beiden Pfade wirkt verstärkend auf das Bewegungsprogramm in der Hirnrinde, der andere hemmend. Ausgeführt wird das Programm am Ende nur, wenn der verstärkende Pfad die Oberhand gewinnt. Und ob das der Fall ist, hängt wesentlich von der Ausschüttung des Neurotransmitters Dopamin in den Basalganglien ab.
Im gesunden Gehirn wird Dopamin immer dann ausgeschüttet, wenn wir eine Belohnung erfahren, etwa nach dem Biss in ein unerwartet leckeres Stück Kuchen. Besondere Wirkung entfaltet der Neurotransmitter dann im sogenannten Nucleus Accumbens, einem zentralen Teil der Basalganglien. Er integriert emotionale Inputs, etwa solche, die Angst signalisieren, und Sinnesdaten wie etwa den aktuellen Kontext. Die Kombination dieser Daten entscheidet darüber, ob der verstärkende oder hemmende Pfad gewinnt. Wenn nun eine Handlung eine unerwartete Belohnung einbringt, dann bewirkt das Dopaminsignal im Nucleus accumbens, dass der hemmende Pfad weniger effizient arbeitet, der verstärkende Pfad aber zugleich deutlich effizienter. Werden die Basalganglien wiederholt von einem extremen Belohnungssignal überflutet wie beim Gebrauch von Drogen wie Heroin, Kokain und Crystal Meth, wird das vorige Verhalten schnell zum unwiderstehlichen Verlangen.
Nicht nur Drogen
Nicht nur chemische Drogen können die Basalganglien auf diese Weise kapern. Auch Glücksspiel-Automaten und Konsolen-Spiele sind so programmiert, dass der suchtbildende Charakter ihrer Belohnungen maximiert wird. Die Grundlagen dafür wurden in den 1950er und 1960er Jahre vom Verhaltensforscher Burrhus Frederic Skinner aus Harvard gelegt. Skinner konnte zeigen, dass Versuchsratten eine belohnte Handlung, zum Beispiel das Drücken eines Hebels im Käfig, dann am häufigsten wiederholen, wenn die Belohnung nur unregelmäßig auf die Handlung folgt. Solche „intermittierenden Verstärkungspläne” wurden bald fester Bestandteil der Programme von Glücksspiel-Automaten. Sie werden aber auch zunehmend in Online-Rollenspielen eingesetzt, die heute an Konsolen oder Computern gespielt werden. Erhöht wird das Sucht-Potential auch dann, wenn ein Spiel zu Beginn häufig eine Belohnung einbringt — zum Beispiel kleine Gewinne am Automaten oder eine besondere Waffe im Computerspiel — nur um dann langsam weniger ergiebig zu werden. In einem Punkt sind Computerspiele sogar noch suchtfördernder als Automatenspiele. Sie enthalten mit dem sozialen Feedback der Mitspieler eine zusätzliche Belohnungsquelle. In der Kombination können die drei Risikofaktoren — intermittierende Verstärkungspläne, Glücksspielcharakter und soziales Feedback — das Belohnungssystem des Gehirns auf Dauer ebenso übernehmen wie eine suchtbildende Droge. Im Jahr 2018 nahm die WHO die Computerspielsucht in ihren diagnostischen Katalog ICD-11 auf und trug damit der Suchtgefahr des „Gaming” Rechnung.
Nicht nur bei Spielen werden die suchtbildenden Mechanismen der Basalganglien ganz bewusst ins Design integriert. In der Psychologie gibt es eine Schule, deren Prinzipien heute die Funktionen der sozialer Medien leiten. Gründer des „Behavioural Design” ist der Psychologe B.J. Fogg aus Stanford. Laut Fogg müssen drei Bedingungen erfüllt sein, damit ein Mensch eine erwünschte Handlung ausführt. Erstens müsse er zu der Handlung motiviert sein, zweitens fähig sein, sie auszuführen, und dritten bedürfe es eines konkreten Auslösers. Ein Beispiel für die Umsetzung dieser Prinzipien ist die Nachrichtenfunktion von Facebook: Der Nutzer will Kontakt zu seinen Freunden halten (Motivation), Facebook macht das mit Hinweisen auf die Aktivität der Freunde einfach (Fähigkeit) und der rote Benachrichtigungshinweis ist ein nahezu unwiderstehlicher Auslöser. Kommt dann eine Interaktion zwischen Freunden zustande, gibt es in den Basalganglien ein starkes Belohnungssignal, das die Wahrscheinlichkeit erhöht, beim nächsten Mal wieder den kleinen roten Kreis mit der Nachrichtenzahl anzuklicken. Welchen Langzeiteffekt das Behavioural Design auf das Gehirn des Menschen hat, ist noch nicht geklärt. Eine Diagnose wie bei der „Gaming-Sucht” gibt es bisher nicht. Dennoch gilt „Internetsucht” heute unter Psychotherapeuten heute als eine ernst zu nehmende Störung des Verhaltens.

Der Kontext ist entscheidend
All diesen Formen der Sucht gemein ist der starke Einfluss des Kontextes. Denn wie der rote Button bei Facebook, ist auch Umgebung, in der die Belohnung zuerst erlebt wurde, ein Auslöser für späteres Suchtverhalten. Christiane Felschenirow konnte dem Suchtkontext ihrer Jugend, des Bahnhof Zoo zwar entfliehen. In ihrem Buch „Mein zweites Leben” beschreibt sie, wie sie zuerst nach Griechenland auswanderte und dann mehrere Jahre bei einer neuen Freundin, der Malerin Anna Kehl aus Zürich, lebte. Dort aber zog es sie immer wieder zum sogenannten Platzspitz, einem Park im Herzen der Stadt, der damals die wohl größte Drogenszene Europas beherbergte. Allein das Wissen um die Verfügbarkeit von Heroin in jenem Park vermochte in Felschenirow das am Bahnhof Zoo eingeübte Verhaltensmuster auslösen.
Eine Sucht ist also eine Dysregulation der Handlungssteuerung, ausgelöst von Substanzen oder von Verhaltensweisen, die in den Basalganglien ein sehr starkes und wiederholtes Belohnungssignal auslösen. Das dabei ausgeschüttete Dopamin stärkt Verbindungen im Nucleus Accumbes, die die Wiederholung vorangegangene Verhaltensmuster wahrscheinlicher machen. Nicht nur bei Drogen kapert diese Verstärkung auf Dauer die Basalganglien und damit manchmal das gesamte Leben eines Menschen.
Christian Honey im OPUS Kulturmagazin Nr 81 (September / Oktober 2020) zum Schwerpunkt „Sucht“