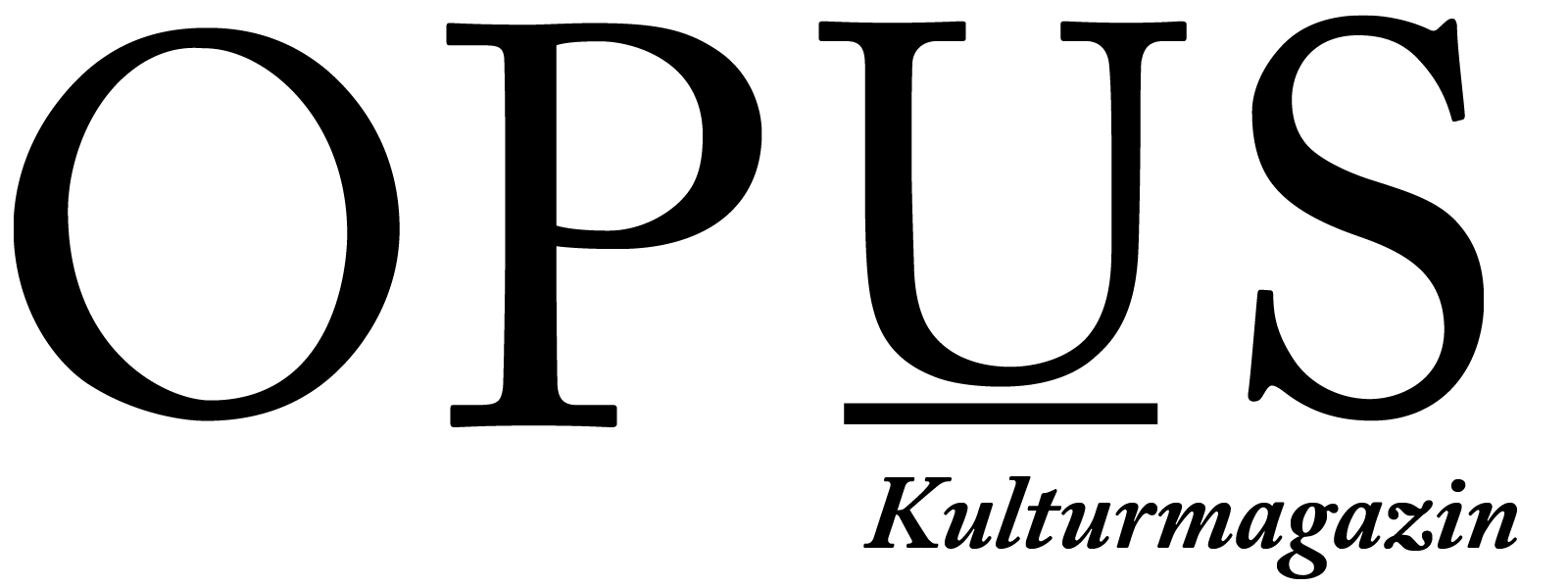Szenenbild aus „Rheingold“ © Martin Kaufhold / Saarländisches Staatstheater
Die Vertreter der reinen Lehre, die Hardliner unter den Wagnerianern und Bewahrern, denen die Musik Wagners heilig ist, brachen in ihre schon fast obligatorischen und erwartbaren Buhs aus, als sich der Vorhang nach dem letzten Akkord der Oper „Das Rheingold“ geschlossen hatte, auf der Bühne des Saarländischen Staatstheaters, das den gesamten „Ring“ im Laufe der kommenden Jahre herausbringen wird.
Die Sprache und die Musik, die Geschichten und Sagen von Königen, Helden, von Göttern und Intrigen, all das wirkt für viele, namentlich jüngere Zuschauer heute eher verstörend, völlig aus der Zeit gefallen. Für sie sind das Geschichten, die mit unserem Leben nichts zu tun haben. Die Musik allerdings fasziniert weiter … und die Geschichte darf man, muss man wohl immer neu erzählen, neu deuten. Das tut das ungarische Regieteam mit Alexandra Szemerédy und Magdolna Parditka – und zwar ganz anders, als man erwarten durfte. In Saarbrücken ist Walhalla ein Laboratorium, in dem offensichtlich auch Menschenversuche gemacht werden, die Burg Walhalla ist ein DNA-Strang, die Rheintöchter sind medizinisch-technische Assistentinnen, der Nibelungenschatz ist das Wissen der Forscher, das sind aber auch neugeborene Babys, den Müttern entrissen, und auf den Laboratoriumstischen für Experimente genutzt. Die Götter sind Ärzte, alle in weiß, alle mit Sidecut Frisur, teils mit durchsichtigen Ganzkörperanzügen, wie man sie aus den Intensivstationen der Corona-Zeit kennt.
Aus Göttern werden Menschen und es sind die Engel in Weiß, die Mediziner, die hier das Sagen haben. Das Laboratorium ist der Ort, an dem Zukunft gemacht wird und in dem sich eine Elite anschickt, die Entwicklung und schließlich die Macht an sich zu reißen. Es gehe, so Alexandra Szemerédy, „auch um die Grenzen des Menschseins, um die rasante Entwicklung der Technologie. In unserer Konzeption unternehmen wir ein Gedankenexperiment: Was passiert mit einer Gesellschaft, in der nur Privilegierte Zugang zu Formen der Selbstoptimierung wie z.B. Genetic Engeneering oder Künstlicher Intelligenz haben, in der“Designerbabys“ zur natürlichen (Aus)wahl werden“. Insofern kann man das neugeborene Baby, das Erda entrissen wird, auch als den eigentlichen Nibelungenschatz auffassen und natürlich das Wissen über die neuesten Techniken. Der Mythos ist eine hochtechnisierte Welt. Doch – und das zeigt die Inszenierung – die alten Beziehungsnetze, die alten menschlichen Auseinandersetzungen bleiben, wie auch die alten Träume von ewiger Jugend und ewigem Leben. An dieser Stelle bricht das Regieteam nicht mit der Wagner‘schen Welt. Der Apfel Freias ist Verführungs- und Überlebensmoment. Im Götterolymp ist alles wie beim alten Wagner.
Das technisch anmutende Bühnenbild hat zwei Ebenen: eine untere, in der die Rheintöchter wohnen und die wie ein Laboratorium gestaltet ist, in dem die Laborantinnen mit Pipetten arbeiten. Rein-Raum steht sinnigerweise an der Tür. In der oberen Ebene befindet sich der Götterhimmel, mit Couchecke für Wotan und mit einem Fitnessraum für Donner und Froh.
Wotan ist Peter Schöne, mit ausdrucksstarkem Gesang, aber auch mit überzeugendem Spiel – körperlich eigentlich keine ‚Wotan-Figur‘, wie man sich vorstellen kann, doch er hat im Chefarztkittel trotzdem Gewicht. Judith Braun als Fricka hat viele wunderbare Momente. Einer der Besten war Algirdas Drevinskas als Loge. Leider war Werner van Mechelen, der den Alberich spielten sollte, sehr kurzfristig erkrankt. Noch am Vormittag der Premiere konnte man Christian Henneberg gewinnen, der vom Pult aus sang, während der Regieassistent Gaetano Franzese die Rolle auf der Bühne verkörperte.
Was einem schnell auffällt, ist die latente Aggression fast aller Protagonisten, die erst mit dem Auftritt der Erda in einem Paradiesgarten einen Wärmestrom erhielt. Sie, Melissa Zgouridi, wurde am Ende auch ganz besonders bejubelt. Sie ist längst ein Publikumsliebling in Saarbrücken geworden.
Das Orchester war tadellos und Sébastien Rouland hatte die Balance von Bühnenstimmen und Orchester sehr gut in der Hand. Er ließ es krachen, wenn es musste, wusste sich mit dem Instrumentalpart auch zurückzunehmen, wenn es intimer wurde. Sehr schön musizierte er das Rauschen der Rheinwellen, ein Ligeto-ähnliches Klangfeld.
„Darf man diese Oper so inszenieren?“, fragte jemand nach der Aufführung. Man darf, man sollte sogar, denn neue Bühnenräume tun der Oper gut.
Friedrich Spangemacher