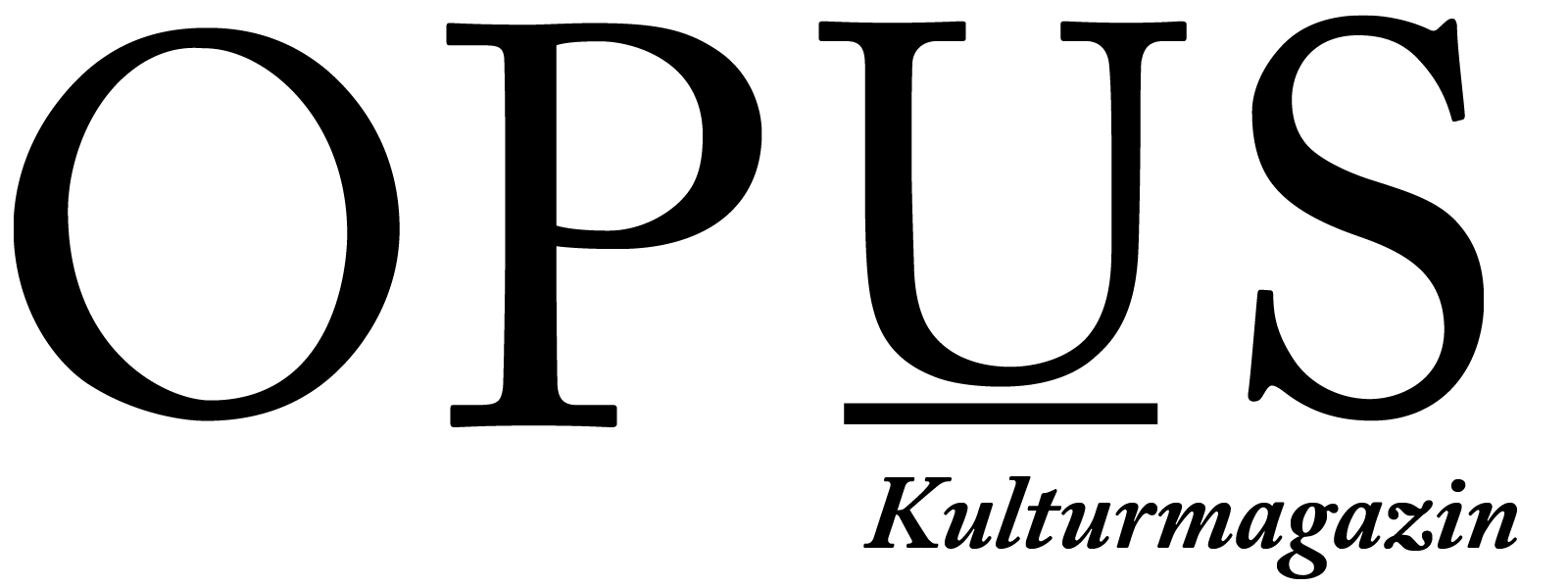Foto: Szene aus La Bohème am Theater Trier, Inszenierung Mikael Serre © Martin Kaufhold
von Eva-Maria Reuther
Unlängst empörte sich eine Bekannte, sie fahre nicht mehr zu den Salzburger Festspielen, seit dort Don Giovanni in Unterhosen aufgetreten sei. So etwas sei eine unerträgliche Zumutung. Mein Einwand, dass für einen libertinösen Herzensbrecher Unterhosen doch ein sehr passendes Kostüm seien, und man im Übrigen andere Helden sogar ohne jegliche Bekleidung gesehen habe, wenn die Regieidee das erfordere, wurde mit einem „Das geht zu weit“ barsch abgeschmettert.
Nun ist besagte einstige Festspielbesucherin keine Hinterwäldlerin, sondern eine leidenschaftliche Kunstfreundin, die in der bayrischen Hauptstadt durch ihre regelmäßigen Besuche Museen und Theater nach Kräften unterstützt. Dennoch repräsentiert ihre Haltung die vieler Theaterbesucher. Was aus künstlerischer Sicht sinnfällig und innovativ erscheint, ist oftmals dem Publikum eine verstörende Grenzüberschreitung, schon gar, wenn es die eigenen Erwartungen für künstlerisch verbindlich hält und lieber Traditionen repetiert, als sich dem Risiko des Unbekannten auszusetzen. Der guten Ordnung halber sei klargestellt, dass auch das Neue nicht automatisch das Bessere oder Qualitätsvollere ist. So manche dramaturgische oder ästhetische Innovation sah bei Lichte besehen, dann doch ziemlich alt aus. In keinem Fall ist das Theater allerdings aus der Verantwortung entlassen, dem Publikum neue Erfahrungen zuzumuten und unbekannte Perspektiven zu eröffnen. Gerade das öffentlich hochsubventionierte Theater muss seinen Beitrag zu einer offenen, soll heißen aufgeschlossenen, Gesellschaft leisten und sie mit der Welt verbinden. Dazu kommt es nicht umhin, mit seiner dramatischen Kunst immer wieder weiter und „zu weit“ zu gehen und Erwartungshorizonte zu überschreiten. Nur so kommt auch sein Publikum voran. Dass sich das Theater als Reflexionsraum der Gegenwart und seine Macher mit solcherart Zumutungen schon mal ein blaues Auge holen (sinnbildlich gesprochen), gehört zum Berufsrisiko.
Aber nicht nur ums Publikum geht es. Auch die Institution Theater selbst ist darauf angewiesen, sich etwas zuzumuten. Ist doch der permanente ästhetische und inhaltliche Erneuerungsprozess sein Lebensnerv. Wie alle Kunst entsteht auch die Bühnenkunst in und aus ihrer Zeit. Wo sie historische Stoffe verhandelt, muss sie sich als Gegenwartskunst verständlich machen. Nur so bleibt Hamlet ein Zeitgenosse und Shakespeare so gegenwärtig wie Wolfram Lotz oder Lukas Bärfuss. Mit Recht warnt Peter Brook in seinem Essay „Das tödliche Theater“, dass ein Theater, das lediglich museale Denkmalpflege betreibt, tot im vermeintlichen Leben ist.
Ein „intellektuelles Publikum“ wünscht sich die neue Schauspielchefin der Salzburger Festspiele Marina Davydova, die wegen ihrer kritischen Haltung zum Ukraine-Krieg Russland verlassen musste. Das mag für manchen Kulturpolitiker, der sich „Kultur für alle“ auf die Fahnen geschrieben hat, verdächtig elitär klingen. Im massenmedialen Zeitalter, in dem man sich das Denken von Talkshows, Expertenrunden und sozialen Netzwerken abnehmen lassen kann und es genügt, sich im Bauchladen aktueller gesellschaftspolitischer Debattenbegriffe zu bedienen, ist es fraglos unpopulär und beschwerlich, sogar allzu oft nachteilig, als Einzelner einen differenzierten Diskurs zu fordern und sich unabhängige intellektuelle Aktivität vorzubehalten. Erst recht, wenn die sich dem Gesinnungsmainstream querlegt. Vielleicht muss man auch wie Davydova erst aus einer Diktatur fliehen, um die Vorzüge des kritischen Diskurses und der eigenständigen intellektuellen Position für nicht verhandelbar zu halten. Aber gerade die sollte das öffentliche Theater einer Demokratie fördern.
In diesen Tagen kämpft das Theater an vielen Fronten. Wer sich in der deutschsprachigen Theaterlandschaft umhört, vernimmt vielerorts ein Stöhnen angesichts der zögerlich oder gar nicht zurückkehrenden Zuschauer. In Zeiten, in denen „ausverkauft“ auch für zahlreiche öffentliche Träger das ultimative Qualitätskriterium zu sein scheint, setzen die durchlöcherten Stuhlreihen die Intendanzen erheblich unter Druck. Zuweilen hat das skurrile Folgen. So stellten sich unlängst der Intendant des angesehenen Thalia Theaters, Joachim Lux, und ein Kollege vom Boulevard mit Schildern um den Hals in Hamburg auf die Straße, auf denen die Passanten aufgefordert wurden, ins Theater zurückzukehren. Schlechtere Nerven hatte angesichts der Leere die Intendantin des Deutschen SchauSpielHauses Hamburg, Karin Beier, die über die angeblich unverständige Theaterkritik als Kunstbeschmutzer schimpfte.
Dass die Pandemie den Theatern wie der gesamten Kultur einen empfindlichen Schlag versetzt hat, ist unbestritten. Sie allein für die Besucherflaute verantwortlich zu machen, ist allerdings das, was der Philosoph Peter Sloterdijk ein „Gedankensparprogramm“ nennt. In der mäßigen Nachfrage nach Theaterkarten stellt sich fraglos auch die seit langem latente Legitimationskrise des Theaters dar. Tatsache ist, dass laut den Statistiken der letzten zehn Jahre nicht mehr als zwei bis drei Prozent der Bevölkerung (bei Befragten ab 14 Jahren) regelmäßig ins Theater gehen. Immerhin 30 Prozent geben „gelegentliche“ Theaterbesuche an. Dieses Stammpublikum zu erreichen, scheint zunehmend schwerer. Das Theater rettet sich in wenig überzeugende aber nichtsdestotrotz gebetsmühlenartig repetierte Erklärungsmuster. Der „alte weiße Mann“, Netflix, die aussterbende Spezies des Bildungsbürgers, die fehlende kulturelle Bildung werden als Schuldige allzu schnell ausgemacht. Um seine Systemrelevanz nachzuweisen, übt sich das Theater in zeitgeistiger, politischer Korrektheit, ist divers, antirassistisch, feministisch, engagiert sich für Klimaschutz und positioniert sich gegen jede Form der Diskriminierung. Im Grundsatz ist dagegen nichts zu sagen. Bedenklich ist allerdings, dass dabei vielerorts kein selbständiger, differenzierter, kritischer Diskurs geführt wird. Stattdessen macht sich das Theater zum willfährigen Propagandisten allfälliger Debattenbegriffe und eines dem Mainstream folgenden fragwürdigen Konsens.
Und wem gar nichts mehr einfällt, der versucht, den Publikumsschwund mit Boulevard in den Griff zu bekommen. Das ist kaum nachhaltig, schon gar nicht, wenn es um öffentlich theatrale Systemrelevanz und Legitimation geht. In Schillers aufgeklärtem Theater sollten die Mächtigen der Welt die Wahrheiten erfahren, die sie sonst nirgends hörten. Wahrheiten zu verkünden, nimmt das Theater schon lange nicht mehr für sich in Anspruch. Und es darf bezweifelt werden, dass die Mächtigen heute noch oft ins Theater gehen. Dafür haben die Mitglieder unserer heutigen Massengesellschaft umso nötiger einen Ort, an dem kritisch hinterfragt wird, was Massenmedien, Influencer und von Image-Beratern ferngesteuerte Politiker ihnen als ultimative Wahrheiten verkaufen. Und genau dieser Ort könnte das Theater und seine Kunst sein. Die zwar in Symbolen spricht, aber im Idealfall höchst unterhaltsam und erhellend ist. Das Publikum will schließlich weder belehrt noch gemaßregelt und schon gar nicht gelangweilt werden, sondern geistig und sinnlich ergiebig unterhalten werden, wie Marie Rötzer mit Recht feststellt, die in der niederösterreichischen 50.000 Seelen-Stadt St. Pölten mit Erfolg als Intendantin ein international aufgestelltes Haus leitet. Um solch ein innovatives, unterhaltsames wie diskursives Theater zu werden, bedarf es allerdings nicht nur des Willens und des Muts, sondern auch einer gewissen Frustrationstoleranz bei der Kulturpolitik, bei den Theatermachern und beim Publikum.
Alles Neue braucht seine Zeit. Und so manches Theater hat nicht nur einen baulichen, sondern auch einen ästhetischen Sanierungsstau.
Eva-Maria Reuther zum Schwerpunkt „Zumutung“ im OPUS Kulturmagazin Nr. 95 (Jan./Feb. 2023)