in der Mitte: Valda Wilson (Sylva Varescu); Ensemble // Copyright: Martin Kaufhold
Operette zum Abgewöhnen
Die „Csardasfürstin“ am Saarländischen Staatstheater
von Friedrich Spangemacher
Das Staatstheater Saarbrücken unter dem Intendanten Bodo Busse hat schon beeindruckende Opernproduktionen mit viel Mut zum Außergewöhnlichen vorgestellt, und so durfte man hoffen, dass sein Theater selbst eine veritable Operette überzeugend auf die Bühne bringen könnte.
Die gute alte Operette mit einem Schuss Musical anzureichern, dieses Konzept hatte Bodo Busse für Emmerich Kálmáns „Csardasfürstin“ angekündigt. Doch dieses Konzept ist nicht aufgegangen. Stattdessen blieb die Inszenierung in weiten Teilen im Klamauk des übertrieben gewollten Operettenfiebers stecken.
Regisseur Erik Petersen versetzte das Stück ins Jahr 1915, in die Zeit der Entstehung der Partitur, mit den Kostümen und der Eleganz jener Jahre (Kostüme und Bühnenbild: Christof Cremer), mit Uniformen, die eher an die einer Blaskapelle erinnerten.
Es gab keinen Zeitbezug auf das Heute, man erkannte allerdings auch nicht, warum es diese strikte Rückschau sein musste – auch musikalisch. Dass die berühmten Melodien, die im „Blauen Bock“ unsere Eltern noch vom Hocker rissen, nicht zündeten, hat sicher damit zu tun, dass man sich heute nur schwer in diese Zeit einfinden kann. ‚Operette pur‘ das scheint heute nicht mehr zu gehen. Unsere Hörgewohnheiten haben sich drastisch verändert. Es hat die Beatles gegeben, es hat Bernstein gegeben, da ist die alte Welt der Unterhaltungsmusik ganz untergegangen.
Interessant ist ja, dass man Opern aus jenen Jahren – etwa von Zemlinsky – hochaktuell empfinden und inszenieren kann, die Operettensprache aber verstaubt klingt. Hinzu kommt, dass das Orchester unterfordert war, d.h. das Schräge eines Kurorchesters (das das Staatsorchester Gott sei Dank nicht hat) hätte dem Stück vielleicht besser getan. Der Seitenblick auf das Musical in der Stimmauffassung und in der Stimmführung gab es sehr wenig her, allenfalls in der Szene „Machen wir’s den Schwalben nach“. Ganz und gar ärgerlich war die Deklamation in den Sprechsequenzen. Das war Präsentation, wie man sie von früher her kennt, aus alten Filmen und Radiosendungen, als man immer mit Nachdruck, Pathos und mit hoher Lautstärke sprechen musste. Das spielte sich oft auf der Vorderbühne ab. Deshalb geriet die Inszenierung immer wieder zu einer Art konzertanter Vorstellung mit bunten Bildern im Hintergrund. Die innere Anteilnahme fehlte, die Gemütsbewegungen der Protagonisten kamen überhaupt nicht ‚raus. Wenn der Liebhaber Edwin zu Beginn vor der Garderobe der Sängerin Sylva mit Rosen steht, nimmt man ihm nicht ab, dass auch nur eine Liebesader in ihm zittert. Die Liebe, die hier so lautstark besungen wird, wird in der Personenführung nicht deutlich. Und wenn sich am glücklichen Ende beide Paare finden, so ist das kein Erlösungsmoment. Die Musik feiert etwas, das man auf der Bühne nicht erleben kann, obwohl die Sänger sehr gut eingestellt waren, vor allem Valda Wilson als Sylva, die die ganze Spannung zwischen einer extrovertierten Varietè-Sängerin bis zur enttäuschten Geliebten wunderbar zum Ausdruck bingen konnte. Akgirdas Drevinskas als Edwin mit seinem schmiegsamen Tenor steigerte sich im Verlauf der Handlung immer mehr. Als Marie Smolka mit ihrer enormen Präsenz als quirlige Komtesse Stasi die Bühne betrat, kam mehr Leben in die Bude. Alle Sängerinnen und Sänger und auch der vorzüglich eingestellte Chor brachten gerade die Operettenhits mit Bravour auf die Bühne.
Und dennoch: Die Zuschauer reagierten brav und schienen nicht überwältigt (es gab nur einen Vorhang). Rudolf Schasching, der den alten Fürsten von und zu Lipper-Weylerheim spielte, bekam nach seinen 20 gesungenen Takten fast den meisten Applaus. Man freute sich über das Wiedersehen. Fazit: Das war keine Neubelebung der Operette, von der Regisseur Petersen träumt, eher etwas zum Abgewöhnen.


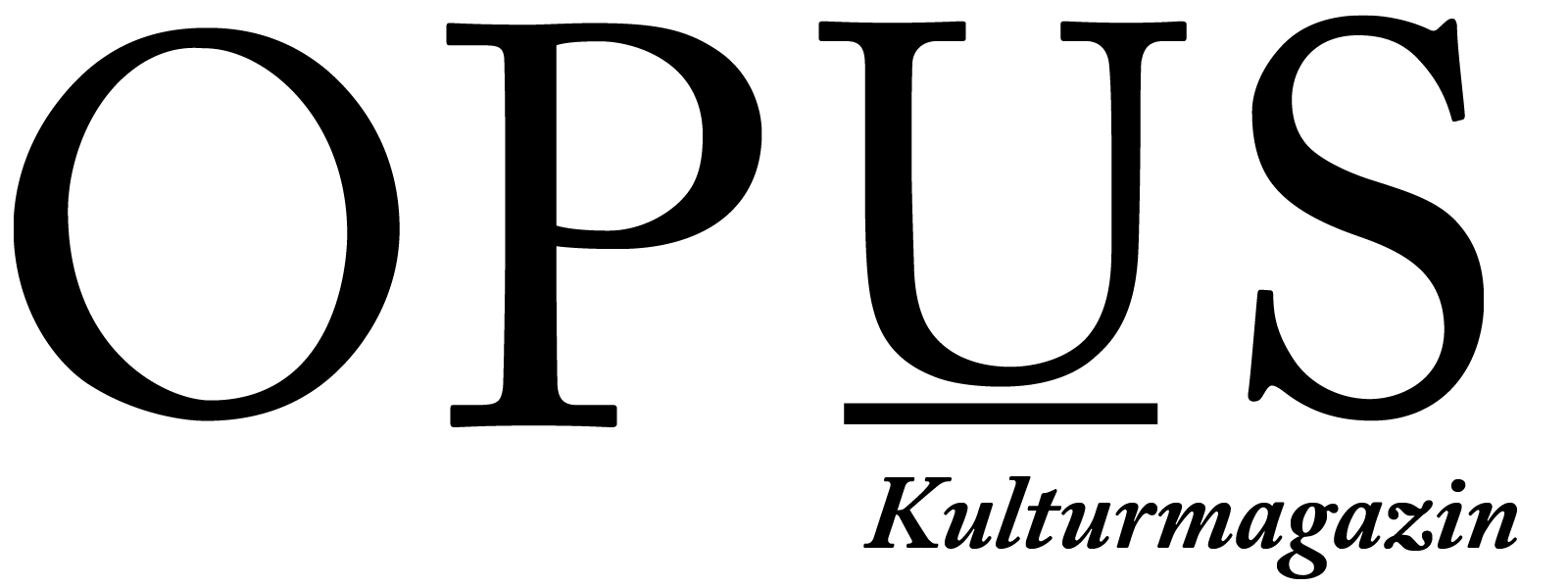
Liegts am Sujet, wie der Autor vermutet, oder scheitert die Zugriffsform? Zündende Operettenaufführungen erlebte ich überwiegend an kleinen Häusern. Am Theater Hof etwa, im österreichische Stadttheater Baden oder dem ungarischem „Budapesti Operettszínház“.