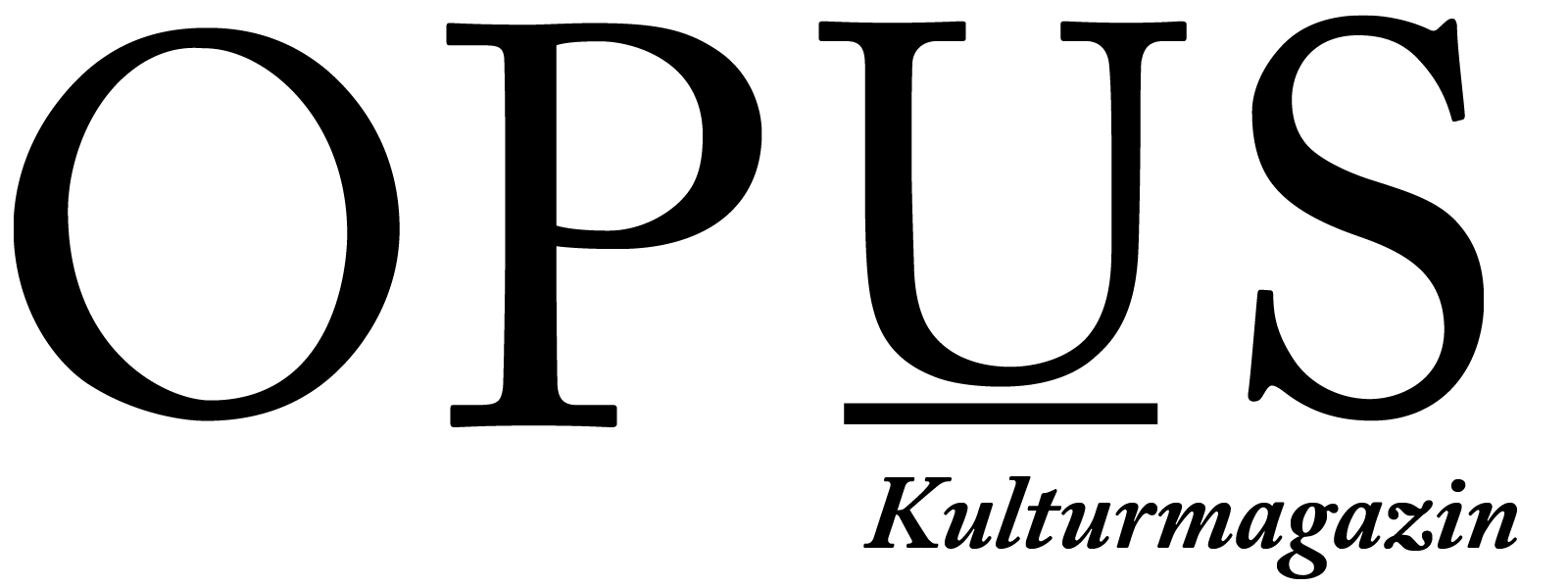Na, welche Serie „bingen“ Sie gerade? Mittlerweile gehört es zum guten Ton bei der Konversation – mit neuen Bekanntschaften oder alten Freunden – den aktuellen Serienkonsum zu diskutieren. Netflix-Verweigerer gibt es selten, aber wer keine Streaming-Plattform abonniert hat, der kann einfach nicht mehr mitreden und wird zum Außenseiter. Bestenfalls versucht man, den Verweigerer aus seiner trost- und serienlosen Welt mit einem Bekehrungsmanöver zu erlösen. Im Worst-Case-Szenario kann der arme Tropf gleich nach Hause gehen, weil er nichts zu melden hat. Doch ganz heimlich stellen sich die Serien-Connaisseure dann die Frage, ob das Leben ohne Streaming nicht vielleicht auch ein echteres wäre? Immerhin nimmt das Konsumieren von Serien einen großen Anteil unserer Zeit in Anspruch. Zeit, in der man in eine fiktive Welt abtaucht. Zeit, in der man sich sozial, kreativ, sportlich betätigen könnte.
Abgesehen vom Gruppenzwang, der heutzutage zum exzessiven Streamen von Inhalten führen kann, sind die Serien auf Netflix, Amazon Prime, Now TV und Co. auch darauf angelegt, süchtig zu machen. Der Begriff „binge-watching“, der im Englischen den ausschweifenden Konsum von Serien beschreibt, wurde im deutschen Sprachgebrauch auf „bingen“ (Aussprache etwa „bin-dschen“) verkürzt. Abgeleitet von anderem, unkontrolliertem Verhalten wie „binge-drinking“ (Komasaufen) oder „binge-eating“ (Überfressen), erhält der Begriff automatisch eine negative Konnotation, die auf ein mögliches Suchtverhalten hinweist. Zumindest sollte man das meinen. Überraschenderweise scheint bingen in Verbindung mit Serien eine Bedeutungsaufwertung erfahren zu haben. Wenn eine Freundin mit strahlenden Augen erzählt, welche Serie sie gerade binged, denkt man sich nicht, dass ihr Verhalten womöglich problematisch sein könnte. Würde sie hingegen vom Komasuff am vorherigen Abend berichten, würden bei den meisten die Alarmglocken läuten.
Gerade während Corona haben Streaming-Plattformen Hochkonjunktur, neben Amazon ist Netflix einer der großen Gewinner der Pandemie. Der Serienkonsum vieler steigerte sich nochmals durch Homeoffice und Lockdown. Und Netflix macht es dem Konsumenten auch wirklich einfach: Die nächste Folge wird dank AutoPlay automatisch abgespielt, man muss sich überhaupt nicht mehr von der Couch erheben. Fernsehen und Kino waren gestern. Und die neuesten Serienhits der Streaming-Plattformen sind auf ein Publikum ausgelegt, das die kürzeste Aufmerksamkeitsspanne der jüngsten (Medien)Geschichte hat. Wir brauchen permanente Berieselung und Stimulation, bei Netflix bekommen wir sie – eine Abhängigkeit entsteht. Seriensucht ist bisher noch nicht offiziell als Suchterkrankung anerkannt, kann aber mit Videospiel-Sucht in einem Atemzug genannt werden – das Suchtmittel ist in beiden Fällen ein Produkt der neuesten Technologie. Im Gegensatz zu Videospielen, die tatsächlich kostspielig sind, kann der Serienjunkie für nur 9,99 Euro im Monat so viele Serien streamen, wie er oder sie will. Damit ist die Seriensucht auch etwas für den kleinen Geldbeutel! Doch der niedrige Preis für diese Massendroge der Digitalisierung, die jederzeit und überall zugänglich ist dank Internet und Apps, ist nicht der alleinige Grund für den erhöhten Suchtfaktor.
Die Konzeption von Serien hat sich in den vergangenen 20 Jahren grundlegend geändert. Wo früher TV-Serien als Freizeitbeschäftigung für die ungebildeten Massen abgewertet wurden, trat spätestens mit David Lynchs „Twin Peaks“ (1990) die Wende zum Qualitätsfernsehen ein. Der amerikanische Pay-TV-Sender HBO steht mit seinen Produktionen wie „Game of Thrones“, „True Detective“ oder „Westworld“ synonym für „quality TV“ vom Feinsten. Aber auch Sender wie AMC („Mad Men“, „Breaking Bad“) oder FX („American Horror Story“, „Sons of Anarchy“) tragen zum neuen Format der qualitativ hochwertigen Serie bei: Komplexe narrative Strukturen, unzählige Handlungsstränge, multiple Cliffhanger, nicht nur von Staffel zu Staffeln, sondern von Episode zu Episode. Man muss wissen, wie es weitergeht, das Abschalten wird zur Qual. Wo man früher bei Fernsehserien eine Episode pro Woche geliefert bekam und sich das Serienschauen durch Spannung und Vorfreude auf die nächste Folge auszeichnete, kam mit DVD-Serienboxen und schließlich Streaming-Plattformen das Binge-Watching.
Netflix produziert seit Jahren auch eigene Serienformate, die mittlerweile zum absoluten „must see“ geworden sind. Nehmen wir als Beispiel die Mystery-Serie „Stranger Things“ (2016 bis heute). Unmengen von Geld werden in die Produktion dieser Hitserie gepumpt: Wo in der ersten Staffel eine Folge 6 Millionen US-Dollar kostete, steigerte sich das Budget in der dritten Staffel auf 15 Millionen pro Episode. Die Spezialeffekte sind natürlich vom Feinsten, besser als jeder Hollywood-Blockbuster. Ein Team von Autoren stellt sicher, dass die Komplexität der Serienwirklichkeit ausgekostet werden kann. Gleichzeitig ist „Stranger Things“ mit seiner stilisierten 80er-Jahre-Ästhetik und Anleihen an Stephen-King-Filme aus eben diesem Jahrzehnt darauf ausgelegt, bestimmte Zielgruppen anzusprechen: Horror-Fans, Nostalgiker sowie Hipster, die dem Eighties Fashion Trend folgen. Überraschenderweise fand die Serie nicht nur beim angepeilten Nischenpublikum Anklang, sondern Genre überschreitend.
Mittlerweile hat sich aus „Stranger Things“ eine der profitabelsten Franchises entwickelt, Fan-Artikel und Kleidung im Stil der Serie gehen weg wie warme Semmel. Liegt die Anziehungskraft der Serie womöglich auch daran, dass sie in einem Jahrzehnt angesiedelt ist, in dem der Alltag zwar durch Prä-Internet-Technologie erleichtert wurde (Telefon, TV, VCR), das Leben im Großen und Ganzen jedoch deutlich entschleunigt und lebenswert erschien? Derzeit wird mit Spannung die vierte Staffel erwartet. Falls Sie „Stranger Things“ noch nicht gesehen haben, wird es jetzt Zeit. Trotz Suchtgefahr.
Sandra Wagner im OPUS Kulturmagazin Nr. 81 (September / Oktober 2020) zum Schwerpunktthema Sucht