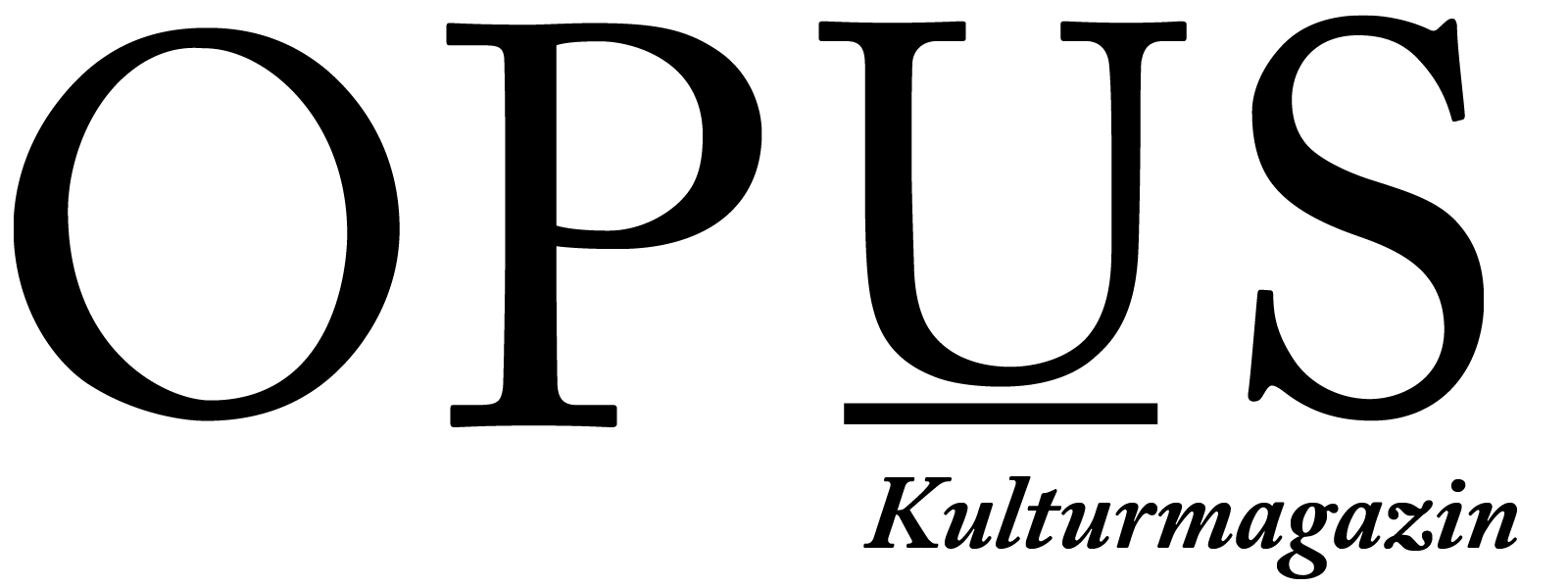Aile Asszonyi (Turandot); Angelos Samartzis (Calaf); hinten: Vadim Volkov und der Opernchor des Saarländischen Staatstheater © Martin Kaufhold
Die neue Inszenierung von „Turandot“ in Saarbrücken
Von Friedrich Spangemacher
Am Donnerstag letzter Woche wurde in Peking die Winterolympiade mit Pomp und Prunk eröffnet, am Samstag hatte die Oper „Turandot“ am Saarländischen Staatstheater Premiere, die auch in Peking spielt. Ob diese Koinzidenz Absicht oder rein zufällig entstand, ist nebensächlich, denn man knüpft als Zuschauer tatsächlich diese Verbindung. Da ist die prächtige Kaiserhymne bei Puccini – die übrigens frappant an die Mao-Hymne „Der Osten ist rot“ erinnert – und da sind die Pekinger Bürger, verkleidet als schwarze Teletubbies mit Mäuseohren, bei denen man an die Kolonnen der Pekinger Corona-Tester in ihren Ganzkörperkondomen denkt, und hier wie da hat die breite Bevölkerung nichts zu sagen…
Aber nein: Turandot, die letzte und unvollendet gebliebene Oper Giacomo Puccinis ist ein Märchen, das wie bei 1001 Nacht irgendwo im Orient spielt. Die Geschichte ist schnell erzählt: Eine Prinzessin am chinesischen Hof gibt allen Brautwerbern drei Rätsel auf, und wer schon eines nicht lösen kann, wird geköpft. Sie hatte Rache geschworen für eine Vorfahrin, die vom Tartarenkönig in einem Krieg vergewaltigt und getötet wurde. Die Leichen der Gescheiterten liegen irgendwann auf der Saarbrücker Bühne, die letzte Hinrichtung wird vollzogen. Da kommt eine kleine Reisegruppe nach Peking, ein abgedankter König, seine Sklavin Liu und sein Sohn, der sich in Turandot verliebt und sich den Rätseln stellen will. Er besteht die Prüfung, und mit eigenem Rätsel kontert er und gewinnt schließlich die Liebe von Turandot.
Als Puccini diese Partitur schrieb, vor ziemlich genau 100 Jahren, da hatte sich die zeitgenössische Musik schon grundlegend geändert, und das blieb auch nicht ohne Folgen für diese Partitur, die alle Seelenregungen der Protagonisten wunderbar und eindrücklich nachzeichnet. Die Harmonik war dissonanter als zuvor, er bezog Erfahrungen mit dem Sprechgesang von Arnold Schönberg ein, es gibt bitonale und heterophone Texturen und Ostinato-Stellen, in denen Strawinsky nachklingt. Und dann aber gibt es im Brennglas diesen einen Edelstein aus dem Belcanto Zeitalter: das “Nessun dorma“, das in den Feststunden der Welttenöre hochglanzpoliert wie ein Popsong abgeliefert wird. Hier – aus der Aufführung heraus und von Angelos Samartzis unvergleichlich gut gesungen und eingepasst, klingt dieses „Nessun dorma“ emotional viel überzeugender. Vieles klang natürlich auch chinesisch. Puccini hatte Inspiration von einer chinesischen Spieldose bekommen, deren Melodien er verwendete. Der Orientalismus der vorletzten Jahrhundertwende spielte ebenso in die Musik hinein wie die Erfahrung mit der sich damals so enorm wandelnden Neuen Musik. Dazu kommt noch, dass die Saarbrücker Inszenierung das Finale in der Bearbeitung von Luciano Berio nutzte, das genau diesen Anschluss an die Musik der Gegenwart damals betonte und die Musik aus dem Feierlich-Hymnischen in die Privatheit der Protagonisten versetzte.
Ja, man entkommt allerdings nicht den modischen Chineoiserien in dieser Inszenierung, etwa wenn die Minister und Gelehrten im Trippelschritt gehen und die Verbeugungen zelebrieren. Die chinesische Vase ist allgegenwärtig, wenn auch in 100 Einzelteilen auf der Bühne verteilt. Obwohl zur Zeit schon der chinesische Tanz aus Tschaikowskys „Nussknacker“ wegen ethnischer Stereotypen im Ballett abgesagt wird, schwelgt die Saarbrücker Inszenierung geradezu von diesen Momenten. Aber sie ist andererseits sehr stimmig mit den vielen rituellen Momenten, die es in der Musik schon gibt und in der Inszenierung wieder aufgegriffen wird, im Zeremoniellen, in den Bewegungen auf der Bühne und selbst im Dialogischen. Die Bühne ist überzeugend einfach: ein Quader, der nach zwei Seiten offen ist und sich je nach Szene auf der Drehbühne wandelt: . Ein Goldhintergrund für Turandot, die schwarz-silberne Mauer für die Volksszenen und das Totenkabinett, das ein andermal als Scherbenhaufen chinesischer Vasen präsentierte wird.
Die Kostüme waren der Schwachpunkt dieser Inszenierung: Die Bürger Pekings als schwarze Mäuse ohne Gesicht, die Reisenden mit Parka, Anorak und hohen Schnürschuhen, der Kaiser, der wie ein Büßermönch aussah, die drei Minister in den schwarzen Ministrantenröcken und Turandot in einem langen Chiffon-Kleid mit Umhang, der man nicht abnahm, dass sie den fremden Prinzen gefallen könnte. Der Prinz Calaf, gespielt und gesungen von Angelos Samarzis, war sängerisch der absolute Höhepunkt der Aufführung. Er setzte sich nicht auf die Töne, sondern brachte seinen Part überzeugend in das Spiel auf der Bühne ein, oft mit erzählerischer Attitüde. Perfekt gesungen und oft mit großer Leidenschaft und Intensität machte er glaubhaft aus dem Prinzen einen Menschen, der sich den Herausforderungen seines Lebens stellt und Emotionen zulässt. Die drei Minister Ping, Pang, Pong wurden von den drei anderen großen Tenören des Staatstheaters gesungen, Peter Schöne, Algirdas Drevinskas und Sung Min Song,: ein fabelhaftes Trio infernal, sängerisch mitreißend, in jedem Terzett mit sicherstem Gespür für die gemeinsame Intonation. Das allein, die Auftritte dieses Trios waren schon ein Stück im Stück. Aile Asszonyi sang die Prinzessin Turandot mit schöner Stimme und ebenso überzeugend stellte sie die kompromisslose Rächerin, aber auch die gewandelte Geliebte zum Schluss dar.
Das Orchester unter Stefan Neubert, mit coronabedingten Aushilfen in letzter Minute, war jederzeit voll im Geschehen und ließ die Ereignisse auf der Bühne zu dem besonderen musikalischen Ereignis werden, das diese Aufführung war.
Zum Schluss vermisst man die liebende Vereinigung von Prinzessin und Prinz, auf die ja alles zulief. Wie die Windsors saßen sie im letzten Bild auf zwei Stühlen im gemessenen Abstand.