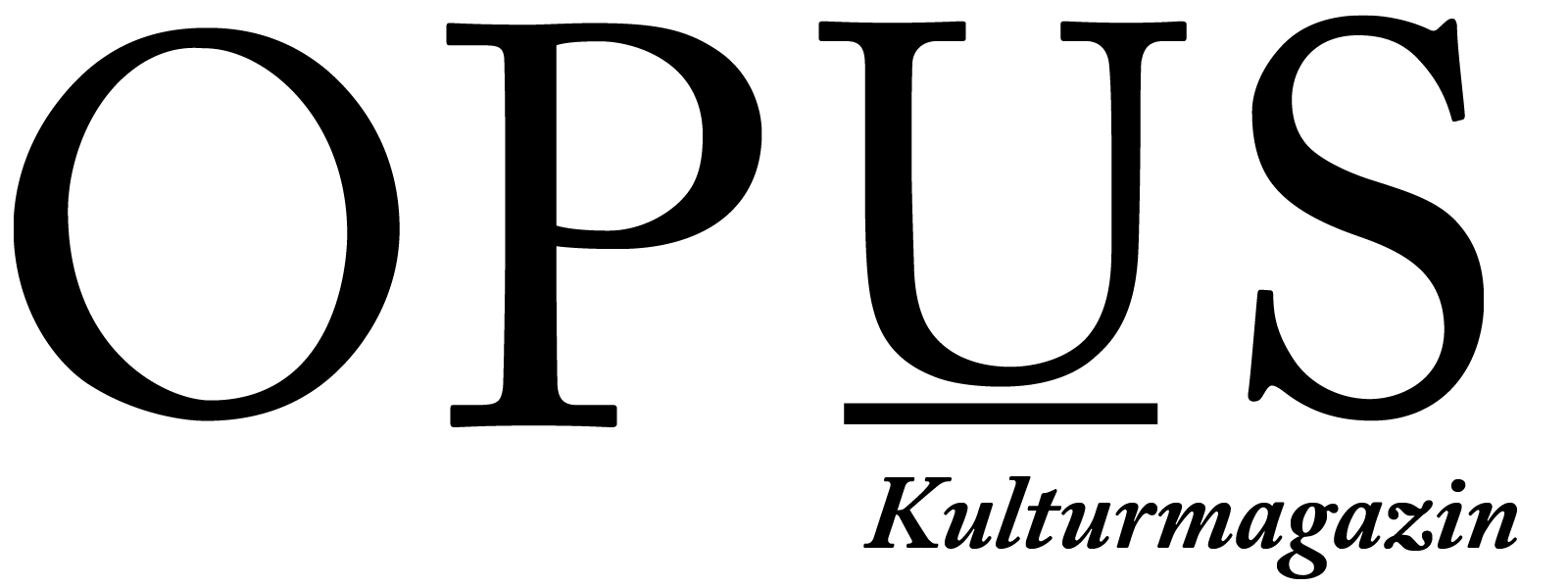Zeitgenössische Inszenierung von La Bohème am Theater Trier von Mikaël Serre © Martin Kaufhold
Natürlich kennen wir unseren Shakespeare: „Wir sind aus solchem Stoff wie Träume, und unser kleines Leben ist von einem Schlaf umringt“. Wer hätte jemals Welterkenntnis poetischer in Worte gefasst als sein Prospero. Wo unser Leben ein Traumland bleibt, ist die flüchtigste aller Provinzen darin womöglich das Theater, mag es sich noch so gegenwärtig und sogar naturalistisch gerieren. Schon wenn der Vorhang fällt, ist unwiederbringlich verloren, was eben noch Bühnenwirklichkeit war. Die nächste Vorstellung ist bereits eine andere, auch wenn sie der vorherigen ähnlich ist. Und selbst die Schauspieler haben morgen eine andere Tagesform als heute, wie auch das Publikum ein anderes ist. Theater lebt vom Wandel, vom temporären, vom inhaltlichen wie formalen. Wie alle Kunst ist auch die darstellende per se zeitgeistig soll heißen ihre Stoffe kommen aus ihrer Zeit, sie reflektieren deren Probleme, geistigen Haltungen und ästhetischen Vorstellungen. Um über die Zeit zu bewahren, was darin an Zeitlosem verhandelt und an Einsichten vermittelt wird, bedarf es der ständigen Aktualisierungen von Narrativen und Ästhetiken, so dass sie dem gegenwärtigen Zeitgefühl ihres Publikums entsprechen. Für die Aufführungspraxis des Theaters ist Ovids Beobachtung, nach der nichts seine Form behält, eine existentielle Grundbedingung. In der Metamorphose zeitgenössischer wie zeitgeistiger Überschreibungen lebt das Theater mit seinen historischen Stoffen fort und bisweilen geht es darin unter.
Unverändert aktuell bleibt bis heute Goethes Forderung: „Wie schaffen wir`s, dass alles frisch und neu und mit Bedeutung auch gefällig sei?“ Wer sich die Theaterspielpläne der letzten 10 Jahre anschaut, wird schnell erkennen, wie notwendig für das Theater solch eine Frischzellenkur an Lesarten, Ästhetiken und Regiesprachen ist, begnügt man sich nicht mit muffigem Wiedererkennungstheater. Gegenwärtige Spielpläne sind mit wenigen Ausnahmen kaum innovativ, schon gar nicht originell. Auch im letzten Jahrzehnt blieben die Klassiker so etwas wie die Basics des Theaters. Noch 2016/17 führte nach der Statistik des Deutschen Bühnenvereins Goethes „Faust“ das Ranking der am meisten gespielten Stücke an, gefolgt von Lessings „Nathan der Weise“. Gut vertreten waren auch Shakespeares Dramen. Nur sieben zeitgenössische Theatertexte konnten sich platzieren. Spitzenreiter unter den neuen Texten war in Zeiten latenter wie gut zu vermarktender Terrorangst Ferdinand von Schirachs Bühnenstück „Terror“. Unter den Opern rangieren wie gehabt ganz vorn auf der Beliebtheitsskala Mozarts „Zauberflöte“, Humperdincks „Hänsel und Gretel“ und Bizets „Carmen“. So konservativ die Spielpläne bleiben, so krampfhaft modernistisch werden die Inszenierungen häufig aufgepeppt. Die Tyrannen der Weltliteratur werden da unversehens zu Donald Trump. Dem dramatischen Bildungskanon wird aufgeklebt, was der Schlagwortkatalog politischer Korrektheit zu bieten hat. Feminismus, Postkolonialismus, Migration, Umwelt und Populismus liegen bei deutschen Theatern voll im Trend der dramaturgischen Ingredienzen inklusive Globalisierung und Kapitalismuskritik der Postmoderne. Da wird es denn auch schnell mal banal, wenn die Gretchentragödie zum trivialen Missbrauchsfall heruntergebrochen wird oder wie in Castorfs finaler „Faust“ Inszenierung die zentrale Botschaft lautet: „Wie man ein Arschloch wird“ (zugegebenermaßen genial in Szene gesetzt). Bei derart platter Aktualität sehnt man sich zurück nach dem derzeit etwas aus der Mode gekommenen Bertolt Brecht und seinen Parabeln sowie seiner Illusionsbrechung, die nicht dazu dient, dass die Spieler auch mal über sich reden können, sondern durch die das Theater wieder dorthin transferiert wird, wo es hingehört. Sprich in den Bereich der Symbolik, in die „Verabredung des Spiels“, wie es die junge Regisseurin Jette Steckel intelligent formulierte. Sie erst machen Utopie und Traum möglich. Natürlich gibt es auch gelungene zeitgeistige Adaptionen, wie etwa Simon Stones Inszenierung der „Medea“, die einen gern unter den Teppich gekehrten, dabei hochaktuellen Aspekt des Migrationsproblems anspricht. Migranten werden geduldet – so Stone – solange sie nützlich sind.
Theater ist wie gesagt vom Zeitgeist nicht abzukoppeln. Kontraproduktiv ist es allerdings, sich ihm anzudienen, oder ihm hinterher zu hecheln, um die eigene Überlebensfähigkeit zu sichern. Zu überdauern, heißt für das Theater, Erhaltenswertes sinnvoll zu vergegenwärtigen, den Nachschub neuer zeitgenössischer Texte zu fördern, sich eines sich ständig wandelnden Publikums bewusst zu bleiben und ohne Qualitätsverlust ökonomisch zu handeln. Am ehesten aber entgeht das Theater in Zeiten von Netflix dem Vergessen, wenn es sich wieder seiner konkurrenzlosen Fähigkeit zur Transzendenz besinnt, eben zu Prosperos Traum. Manchen, aber nicht jeden wird es dabei erreichen. Letzteres ist eine typisch zeitgeistige Überforderung.
Eva-Maria Reuther im OPUS Kulturmagazin 76 (November / Dezember 2019) auf S. 72 f. zum Schwerpunktthema „Vergänglichkeit“.