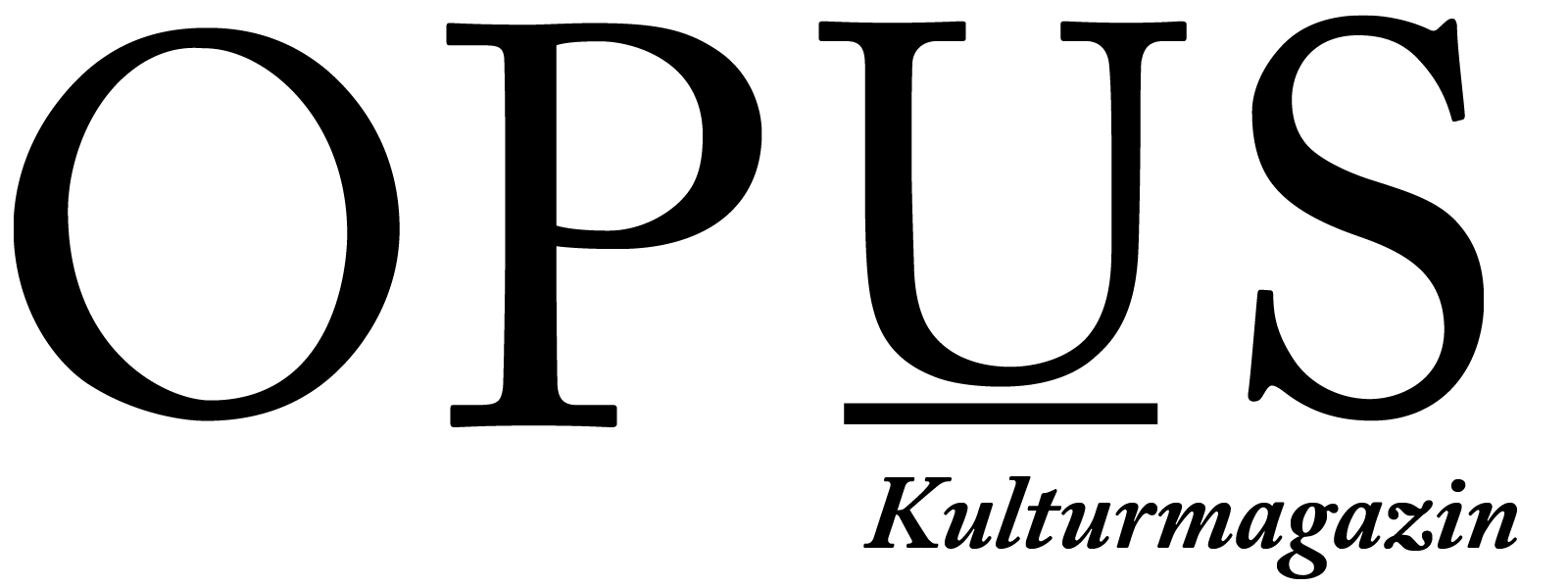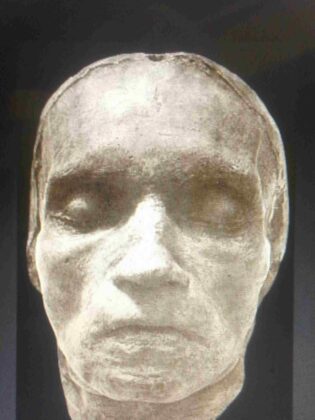
Beethovens Todesmaske © privat
Das Spätwerk von Komponisten zeigt häufig eine neue, abgeklärtere Sicht auf die Welt, es hält Rückschau, zieht Bilanz, und nicht selten hat es visionäre Züge.
Der schwerkranke Debussy hatte sich auf sein bevorstehendes Ende allerdings nicht vorbereitet. Er schrieb verzweifelt: „Ich kann nicht arbeiten, oder ….ich arbeite ins Leere… Nie habe ich mich so erschöpft gefühlt bei dieser Jagd nach dem Unerreichbaren.. Ist es vorbei für mich?“ Sein Spätwerk waren kleinbesetzte Werke, Sonaten, die an die Barockzeit und an Rameau erinnern und die französische Musik verherrlichen sollten. Er wollte sich damit von seinen Depressionen befreien. Ein musikalisches Testament war das nicht.
Ganz anders Ludwig van Beethoven. Dessen weit in die Zukunft reichenden Spätwerke haben lange Zeit Rätsel aufgegeben. Seine Klaviersonate op 111, auch ‚Testament-Sonate‘ genannt, oder seine späten Streichquartette haben Visionäres, Jenseitiges und Mystisches. Wendell Kretzschmar lässt sich in Thomas Manns „Doktor Faustus“ darüber aus. Die Werke der letzten Periode seien geprägt „von einem Prozeß der Auflösung, der Entfremdung, des Einsteigens ins nicht mehr Heimatliche und Geheure“. Das hätten Verehrer als einen Exzess an Grübelei und Spekulation aufgefasst. Das Künstlertum in Beethoven habe sich selbst überwachsen, sie sei „aus wohnlichen Regionen in Sphären des ganz und gar nur Persönlichen aufgestiegen“. Und doch hielt er sich wieder strenger an Konventionen. Das Subjektive und die Konvention gingen ein neues Verhältnis ein, bestimmt vom Tode. Und Kretzschmar resümiert: „Wo Größe und Tod zusammenträten, da entstehe eine der Konvention geneigte Sachlichkeit, die an Souveränität den herrischsten Subjektivismus hinter sich lasse, weil darin das Nur-Persönliche, das doch schon die Überhöhung einer zum Gipfel geführten Tradition gewesen sei, sich noch einmal selbst überwachse, indem es ins Mystische, Kollektive geisterhaft eintrete“. Peter Tschaikowsky hielt das für eine Verirrung:„Es ist ein Schimmer da, aber nicht mehr. Der Rest ist Chaos, über dem der Geist dieses musikalischen Jehova schwebt.“
Damals war Beethoven längst völlig ertaubt, und er konnte seine Werke nur mit dem inneren Ohr hören. Ihm ging es vorwiegend um die Musik und ihre Inhalte.
Das kann man auch bei Johann Sebastian Bach beobachten, der die „Kunst der Fuge“, eines seiner zentralen Spätwerke, eigentlich für Aufführungen nicht vorgesehen hatte. Es ist eine faszinierende fundamentale Studie, eine Serie von unterschiedlichsten Fugen über ein einziges Thema, „Bach will Wesentliches artikulieren und zusammenfassen“, schrieb Martin Geck. Dieser Vorsatz soll sich in Zyklen niederschlagen, um einer Sache auf den Grund zu gehen, um den Reichtum der Musik an einem Modell thematisch darzustellen. Bach suche, so Geck „einen musikalischen Ausdruck, der jenseits von Gattungen und Stilen existiert, also Musik an sich ist“. Die „Kunst der Fuge“ war so etwas wie ein musikalisches Testament und zugleich eine Vision. Paul Bekker bezeichnete das als „ ein ständiges Streben in die Höhe wie ein silberner Faden zwischen Erde und Himmel“. Viele halten die Spätwerke Bachs wie die „Kunst der Fuge“ und das „Musikalische Opfer“ für den Gipfelpunkt der Musik schlechthin. Und es war auch sein Abschied. Albert Schweitzer interpretiert: „Den sterbenden Meister umtönten bereits Sphärenharmonien. Darum klinge kein Leid mehr in seiner Musik nach; die ruhigen Achtel bewegen sich schon jenseits jeglicher Menschenleidenschaft; über dem Ganzen leuchtet das Wort: Verklärung!“
Friedrich Spangemacher im OPUS Kulturmagazin 76 (November / Dezember 2019) auf S. 75 zum Schwerpunktthema „Vergänglichkeit“.