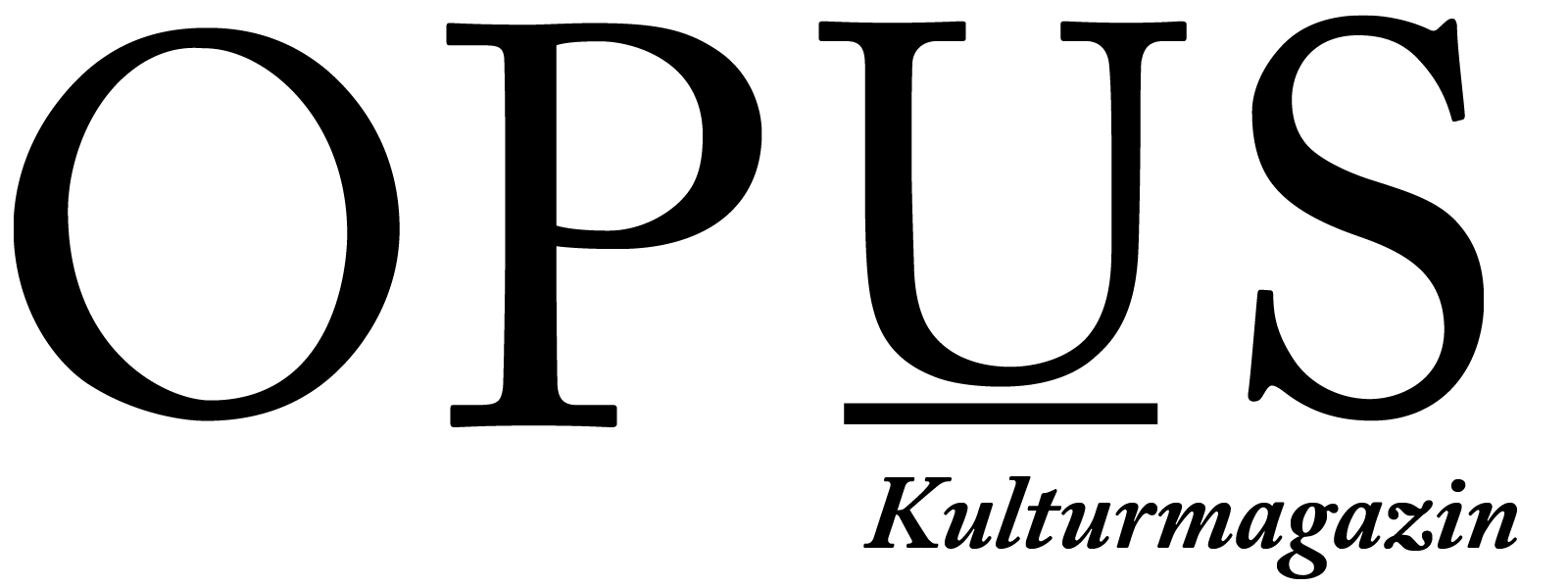Bild: Alexander Nerlich © Foto Andreas Etter
„Ein Raum für Erzählung, für sinnliches Erlebnis“, „einer der direktesten und offensten Diskursräume, die wir in der Gesellschaft haben“, ein Ort, wo „Publikum und Akteure zusammen etwas erschaffen“ – all das bedeutet Theater für Alexander Nerlich. Seit der Spielzeit 2019/20 ist er Hausregisseur am Staatstheater Mainz.
Mit Webers „Freischütz“ bringt er ein Werk auf die Bühne, das seit seiner Uraufführung vor 200 Jahren Stilisierung und Vereinnahmung erfahren hat, als „deutsche Nationaloper“ schlechthin, als „urdeutsches Werk“, nur Deutschen verständlich (Wagner). Natürlich werde in seiner Inszenierung „die Rezeptionsgeschichte mitgestreift“; in erster Linie aber wolle er das Werk selbst „von innen heraus erschließen, es auffalten“.
Was hervorkommt, ist das Unheimliche, „der Einbruch des Irrationalen in eine scheinbar geordnete Lebenswelt, der Durchbruch verdrängter Ereignisse.“ Nerlich betont, das sei nicht „von Weber intendiert“, doch versteht er den Freischütz als „Oper, die das Unheimliche zeigt, dass der Teufel da ist, dass die Freikugel fliegt“. Sein Zugriff auf das Werk sei ein „typischer Zugriff für Theater“: „Die scheinbar objektive Bühnenrealität schlägt um in subjektive Wahrnehmung“. Wahrnehmungen spielen in den Köpfen der Handelnden, tauchen als getanzte Träume, Wünsche und Gewaltphantasien auf. Und so ist für Nerlich „Verdrängung das Thema das Abends“.
Zentral dafür ist ein Bild: „In der Mitte klafft die furchtbare Wolfsschlucht und reißt die heile deutsche Welt auseinander.“ Zeitlich belässt die Inszenierung die Handlung nach dem Dreißigjährigen Krieg. Zeitlos aber bleibt die Verdrängung. Nerlich erzählt von einer Hochzeit in Kroatien: „Immer martialischer“ seien die Tänze geworden, den „kollektiven Schmerz“ zu bewältigen. „Alle hatten Schreckliches erlebt oder selbst gemacht“. So interpretiert Nerlich Samiel als „Prinzip Samiel“: „Die dunkle, unheimliche Seite in uns bricht durch“, den ganzen Abend über präsent, verkörpert durch eine Tänzerin (A. Ruffolo), als rote, „androgyne Figur“, als ein „gehäutetes Wesen“ – Rot für die „Innenseite“, für das, „vor dem wir Angst haben“.
Die Inszenierung entstand in Zusammenarbeit mit W. Menardi (Bühne), Z. Bosniak (Kostüme) und J. Hauck (Choreographie): „Wir kreisen auf eigenen Bahnen, aber immer aufeinander bezogen.“ Aufgabe der Regie sei es, eine „Symbiose von Bild und Musik“ zu schaffen, „durch punktgenaue Setzungen“: „Wenn es ineinander geht, dann ist alles machbar.“ Wir sind gespannt auf die Premiere am 20.11.
Ulf Scharrer im OPUS Kulturmagazin Nr. 88 (Nov. / Dez. 2021)