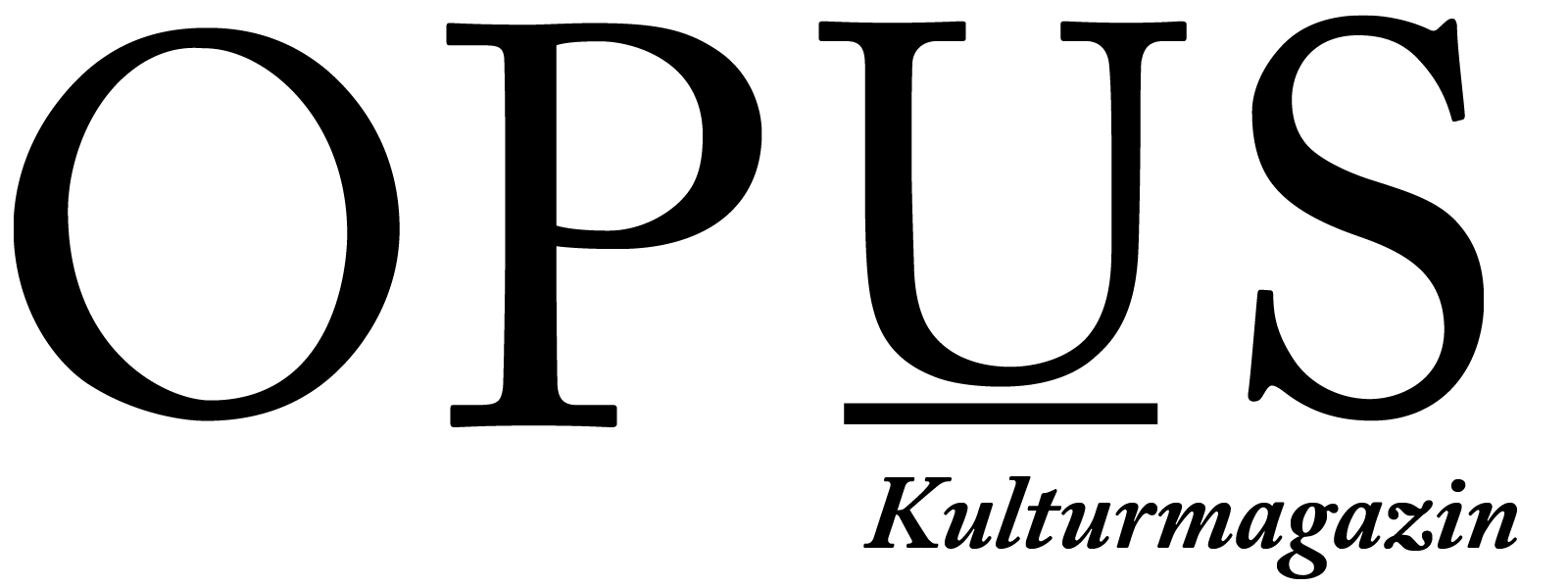Zum Weihnachtsfest kommt oft eine explosive Mischung zusammen © Holle Hoffmann
Im Ausnahmejahr 2020 ist das Weihnachtsfest für viele ganz ausgefallen, zumindest in der normalerweise üblichen Form. Im kleinsten Kreis des eigenen Haushalts wurde gefeiert, keine Elternbesuche, keine großen Runden. Eine interessante Frage wäre, ob 2020 dadurch ein friedlicherer Weihnachtsjahrgang als sonst war: eben weil das große Fest ausfiel und unpersönliche Umstände schuld waren, es also nicht an einem selbst lag, es zu vermasseln? Die Rede ist natürlich von dem legendären Weihnachtsstress, der gewiss nicht in allen, aber doch in nicht wenigen Familien alle Jahre wieder zum großen Zoff ausartet. Auch im mittlerweile zweiten pandemischen Ausnahmejahr kann die symptomatische Repräsentativität dieser Erscheinung noch längst nicht als überholt gelten. Also zum Fest 2021, das vielleicht auch in dieser Hinsicht wieder etwas normaler als 2020 wird, eine kleine Ursachenforschung zum Phänomen des Weihnachtsfamiliendramas.
Die naheliegendste Erklärung ist der überladene kulturelle Stellenwert des Weihnachtsfests. (Dass man es unter permanenter ironischer Distanzierung durchzieht, entspricht nach dem Philosophen Slavoj Žižek nur der zeitgemäßen Form heiligen Ernsts.) Weil dieses Fest uns so wichtig ist, sind überzogene Erwartungen damit verknüpft, weshalb ein hoher Druck auf allen Beteiligten lastet, und der entlädt sich dann irgendwann.
So plausibel das klingt, ist es doch nur ein Teil der Erklärung. Ebenso wesentlich ist die Form, wie Weihnachten typischerweise gefeiert wird. Zwar hat jede Familie ihre eigenen Traditionen, doch sehr häufig werden mehrere der folgenden Elemente vorkommen.
Es kommen zum Fest Verwandte zusammen, die sonst wenig oder gar nichts miteinander am Hut, keinen alltäglichen Umgang miteinander haben, sich vielleicht sogar nie außerhalb des Weihnachtsfests sehen. Und die müssen dann gemeinsam ein Ritual aufführen, dem höchste kulturelle Bedeutung beigemessen wird. Dazu hat Adam Soboczynski 2019 – zum bislang letzten „normalen“ Weihnachtsfest – in der ZEIT ein paar interessante Bemerkungen gemacht.
Es ist ein generationenübergreifendes Drama, das da aufgeführt wird, auch darin liegt Konfliktpotenzial. Und gar nicht primär auf Ebene der Weltanschauungen: Die viel größere Zumutung ist, dass man als Nachgeborener vor allem für die alten Verwandten und die, die man sonst nie sieht, immer das Kind geblieben ist, das man vor Ewigkeiten war. Man hat sich in deren Augen nicht weiterentwickelt und so wird man auch behandelt.
Generell treten sich alle leicht gegenseitig auf die Füße, weil der Umgang miteinander so ungeübt ist. Auch ist die biologische Verwandtschaft soziologisch gesehen oft nicht der Ort, an dem man zuhause ist. Man ist vom selben Stamm, aber wer oder was man heute ist, wird gar nicht recht zur Kenntnis genommen oder mit Unverständnis quittiert. Ich z. B. – Freiberufler ohne festes Einkommen, Kreativbranche, Dr., aber leider phil. – kann wohl in den Augen eines Teils meiner rechtschaffenen kleinbürgerlichen Verwandtschaft eigentlich nicht recht ernstgenommen werden. Und ich selbst hab ja auch kaum eine Vorstellung von dem Leben der anderen.
Ich erinnere mich auch an spektakuläre Großkräche oder Hahnen-Zweikämpfe an Heiligabend, die aus altbundesrepublikanischen SPD-CDU-Gegensätzen eskalierten.
Unter anderen Aspekten wieder sind Verwandte einander zu ähnlich. In der Familie meiner Mutter (das ist bei uns die große Heiligabendrunde) sind alle große Erzähler (besonders die Männer); die hauptsächliche Äußerungsform ist Storys raushauen, das ist nicht so richtig dialogisch. Es reden auch oft alle durcheinander, es geht recht laut zu. Zumindest war das früher so, ach, seit einigen Jahren wird es stiller und das macht mich melancholisch. Doch jedenfalls erleichtert der familiär bedingt gleichartige Kommunikationsstil nicht unbedingt die Kommunikation. Man übertrumpft sich eher, das ist schon an sich eine Art Dauerkonflikt.
Eine andere Kategorie von Faktoren: An Weihnachten ist es draußen in Wirklichkeit selten richtig kalt, aber man sitzt doch in brutal eingeheizten Räumen herum. Dazu isst man viel zu viel, oft wird auch ganz ordentlich getrunken (so bei uns). Eigentlich fühlt man sich volle drei Tage lang körperlich unwohl. Es ist fast so etwas wie eine negative körperliche Hochleistungsveranstaltung: Man bewegt sich kaum, geht kaum raus und absolviert eine Folge ritueller Mahlzeiten. Bei uns kommt noch dazu, dass insb. meine Mutter nichts schöner findet, als wenn sich Abende bis tief in die Nacht hinein ziehen, und alle zum Länger-Sitzenbleiben (und Weitertrinken) nötigt. Dabei ist alles, was nach ein Uhr nachts geschieht, sinnlos bis grässlich. Öfters gab es erst nach Mitternacht noch dramatische Eskalationen, was dann fast eher naturwissenschaftlich zu erklären wäre.
Letzter Punkt (obwohl es noch einige mehr gäbe): Es wird unglaublich viel herumgefahren. Weihnachten ist ja überhaupt ein logistischer Kraftakt, nicht zuletzt aber das Hochfest der Privatmobilität, des Autofahrens. An jedem einzelnen der drei Tage vom 24. bis zum 26. woanders hin oder sogar am selben Feiertag zu zwei und noch mehr Terminen in verschiedenen Häusern, Orten, Bundesländern. Alle sind unterwegs. Vor ein paar Jahren einmal fuhr ich nach einem Weihnachtsessen meine Schwiegermutter nachhause. Auf dem Rückweg lief im Radio das Weihnachtsoratorium von Bach, das war eigentlich der besinnlichste Moment: allein im Auto. Aber ich war mitten am Festabend nicht allein auf der Autobahn. „Fromme Hirten, eilt, ach eilet, eh ihr euch zu lang verweilet!“ Ich sah auf der kurzen Strecke der A623 nicht weniger als vier totgefahrene Tiere.
Und von der Materialschlacht der Bescherung hab ich jetzt noch gar nicht gesprochen! –
Hach, Weihnachten. Trotz allem.
Moritz Klein im OPUS Kulturmagazin Nr. 88 (Nov. / Dez. 2021) zum Schwerpunktthema „Tohuwabohu und Schlamassel“