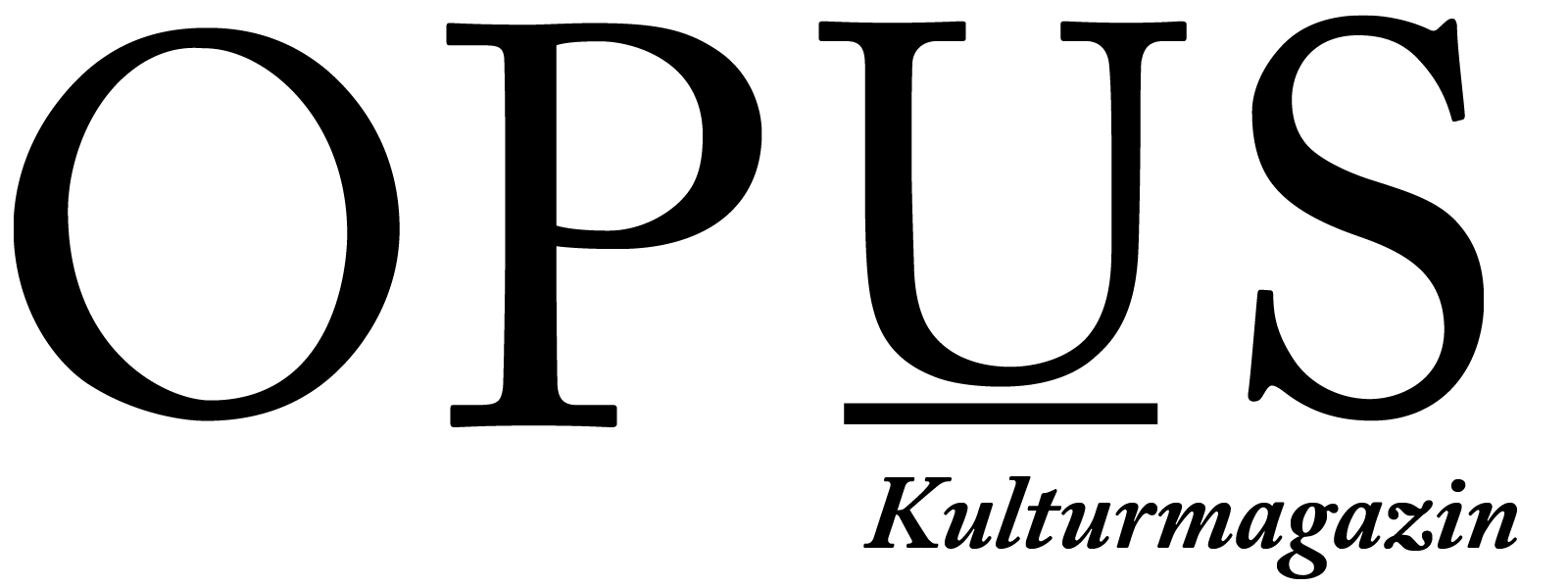Vincent will Meer © Anatol Kotte
Gewöhnungsbedürftig ist es, wenn auf der Bühne im Theater am Ring über 90 Minuten hinweg Schimpfworte fliegen, die dem betagten Publikum wohl die Schamesröte ins Gesicht getrieben haben dürften. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen fixen Einfall der Regie, sondern um eine reale Krankheit: das Tourette-Syndrom. Mit eben diesem hat der Protagonist in Florian David Fitz‘ Schauspiel „Vincent will Meer“ zu kämpfen, wenn die motorischen und verbalen Ticks seinen Alltag bestimmen.
Die Handlung des Stücks ist schnell erzählt: Nach dem Tod seiner Mutter wird Vincent (Markus Feustel) von seinem empathielosen Vater in eine Klinik eingeliefert, wo er die magersüchtige Marie (Theresa Horeis) und den zwangsneurotischen Alex (Marco Reimers) kennenlernt. Kurzentschlossen findet sich das Trio zusammen, um ans Meer zu fahren. Vincent will dort die Asche seiner Mutter verstreuen, Marie möchte der lebenserhaltenden, für sie aber quälenden Zwangsernährung entgehen und Alex wäre eigentlich lieber in seinem keimfreien Zimmer geblieben, kreuzte den Weg der beiden Flüchtigen aber zufällig zur falschen Zeit. So beginnt das Road Movie, das 2010 mit Florian David Fitz und Karoline Herfurth in den deutschen Kinos zu sehen war, mit einer abenteuerlichen Reise, bei der die drei im wahrsten Sinne des Wortes eigenartigen Charaktere gen Süden fahren – gefolgt von Vincents Vater (Till Demtrøder) und der besorgten Klinikleiterin (Marina Weis).
Wer den Film kennt, kennt das Stück. Denn die kaum gekürzte Theaterfassung entspricht der filmischen Verarbeitung des Stoffes nahezu haargenau. Doch wie wird aus der für das Theater zwingenden Einheit des Ortes die sich ständig ändernde Kulisse einer Reise? In Ralph Bridles Inszenierung unterstützen Videoinstallationen die Vorstellungskraft der Zuschauenden: Regen, Sonnenschein, Berge, Tankstelle, Imbissbude – trotz statischen Bühnenbildes in Hanglage. Etwas Fantasie wird dennoch benötigt, denn auch die Requisitenliste ist mit kaum mehr als einigen Zigaretten und zwei losen Lenkrädern kurz.
Den Szenen zu folgen fällt trotzdem leicht, was unter anderem an den kaum überraschenden, stereotypen Charakteren liegt. Damit sind weniger die drei Erkrankten gemeint, die als Personifizierung des jeweiligen Krankheitsbildes ihre Rollen überzeugend spielten (hervorragend: Marco Reimers als zwangsneurotischer Alex), sondern die klischeehaft kettenrauchende Ärztin und der gefühlskalte Vater, rücksichtslos auf seine Politikerkarriere konzentriert und das Sinnbild eines uneinsichtigen Egomanen. Den plötzlichen Sinneswandel zur Mitte der Reise nimmt man ihm nicht wirklich ab – was weniger an der Schauspielleistung Till Demtrøders, sondern viel mehr am sprunghaften Drehbuch liegt.
Was als Komödie begann und dem Publikum nach kurzer Eingewöhnungsphase einige Lacher entlockte, endet in den letzten Minuten überraschend emotional, wenn es um das Leben der stoisch hungernden Marie so kritisch steht, dass auch ihre Weggefährten sie nicht mehr vor einem Klinikaufenthalt bewahren können und wenn der einst miesepetrige Vater wehmütig die Asche seiner verstorbenen Frau ins Meer pustet.
Was bleibt nach dem Besuch der Vorstellung? Das moderne Stück unterhält, es weckt auf und es öffnet den Blick in eine Thematik, die selten auf der Bühne zu sehen ist und vor der auch im Alltag gerne die Augen verschlossen werden. Nähere Informationen zu den Krankheiten bot allerdings nur das Programmheft. Unerfüllt blieb der Wunsch nach einem Rahmenprogramm: eine Podiumsdiskussion, eine Fragerunde mit dem Psychotherapeuten oder dem Tourette-Erkrankten, mit denen die Rollenentwicklung Vincents erarbeitet wurde. Doch die vierte Wand wurde immerhin zu Beginn unterbrochen, als das Publikum mit einer Art „Trigger-Warnung“ vorbereitet wurde auf das, was sie erwarten und was von ihnen erwartet würde: „Lachen, nicht über die Behinderten, sondern mit ihnen.“
Tanja Block