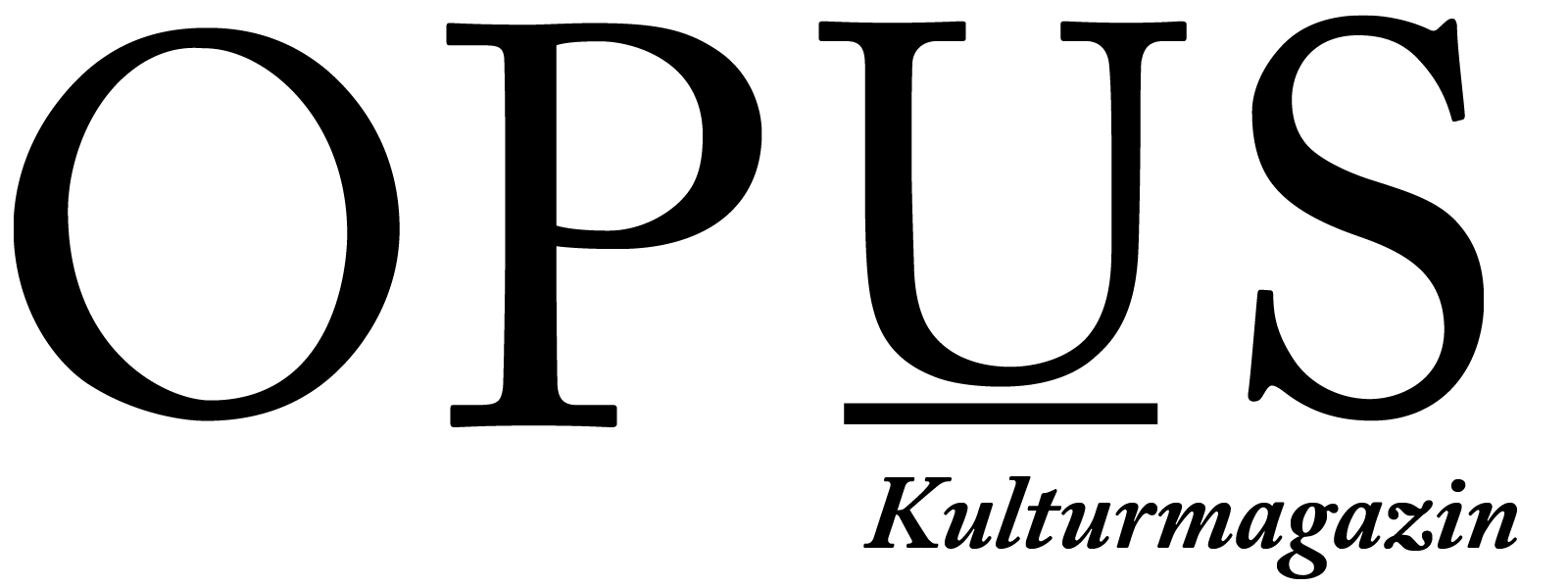Pieter Bruegel der Aeltere, Lust (Luxuria) 1558 © gemeinfrei
Wenn ich vom Glück des Überflusses höre, denk ich an Clara und ihre Freunde. Clara war meine erste große Puppe. Ein heißersehntes Wunschkind, das eines Heiligabends unter dem Christbaum saß und mich aus blauen Glasaugen vertrauensvoll ansah. Clara war Großstädterin aus Dortmund. Das Städtische sah man sogleich an ihrem schicken Deux pièces und der blonden Lockenrolle aus Celluloid. Am Hals trug sie eine Art Tattoo, eine kleine Schildkröte, ihr Markenzeichen. Clara wurde von mir so stürmisch geliebt, dass sie immer mal einen Arm oder ein Bein verlor, einmal sogar den Kopf. Dann musste sie in die Puppenklinik und kehrte nach ein paar Wochen wieder vollends hergestellt nach Hause zurück. Als ich mich für die Mechanismen dieser Welt zu interessieren begann, stellte ich fest, dass Claras Beweglichkeit an zwei Gummibändern hing, die ihren Celluloid-Körper durchzogen. Und als ich einmal rücksichtslos ihren Kopf in die Höhe zerrte, um zu sehen, wie ihr Wendehals (im Wortsinn) funktionierte, entdeckte ich ernüchtert eine schlichte Spiralfeder. Clara hat mir das nie übelgenommen, und ich habe sie wegen der Trivialität ihres Innenlebens nicht weniger geliebt. Zu Clara gesellte sich irgendwann Beate, eine Käthe-Kruse-Puppe, die immer ein wenig auf vornehmer Distanz blieb, mit ihrem beige-rosa Teint, ihren „richtigen“ Haaren und ihrem Organza-Kleid, das so fein war, dass man es in die Reinigung geben musste. Noch etwas später kam ein Dritter im Bunde hinzu, eine dunkelhäutige Puppe. Da ihre beigen Bermudas, ihr buntes Hemd und ihr Knaben-Haarschnitt sie als Jungen auswiesen, nannte ich sie Peter. Auch Peter wurde innig geliebt. Als ihm einmal ein Arm fehlte, war ich bereits an neuen Technologien interessiert, auch im Heilberuf, und klebte den Arm kurzerhand mit Uhu-Alleskleber fest. Danach war Peter fast der alte. Nur wenn er zwischen Clara und Beate saß, wirkte er immer etwas steif. Der Luxus, die drei Puppen zu besitzen, bereitete mir nicht nur unendlich Freude, er verhalf mir im Spiel auch zu Horizonterweiterung und neuen Erlebnisräumen. Schon damals wurde mir – noch unbewusst – klar, dass es einen notwendigen Überfluss außerhalb des Konsums geben muss. Das diverse Puppen-Trio führte mich ein in die „Ökonomie des Herzens“, die nun mal keine Nullrechnung ist, sondern eines gehörigen Maßes an Überfluss bedarf, an emotionalem Luxus sozusagen, als Investition und gewinnbringendem Stammkapital. Der Überfluss sei eine Notwendigkeit, befand der scharfsinnige Voltaire. Das bestätigen auch all die scheinbar unnötigen Dinge, die wir sammeln, pflegen und lieben, mit denen wir uns umgeben, und zu denen wir zu uns selbst zurückkehren, wenn wir zu ihnen zurückkommen. Unsere Bibliotheken, unsere Bilder, das ererbte Service oder vielleicht sind es auch nur die gesammelten Steine vom Ferienstrand oder die exotischen Ohrringe, die zu Hause nie mehr getragen, aber immer bewahrt wurden.
Die Diskussion um den Überfluss bis hin zu seiner Verteuflung ist uralt. Luxus und Überfluss gelten und galten als Quelle von Dekadenz und Ausschweifung. Für das Christentum ist „luxuria“ sogar eine Todsünde. Grässliche Ungeheuer vergnügen sich im gleichnamigen Gemälde von Pieter Brueghel dem Älteren. Eiferer wie Savanorola wollten gleich jeden, der in den Verdacht eines luxuriösen Lebens kam, auf den Scheiterhaufen schicken. Mit Härte und Entsagung kämpft das Ideal der spartanischen Erziehung gegen jeglichen Überfluss. Die Verwerfungen der modernen Konsum- und Wegwerfgesellschaft, das Bewusstsein für die sich verbreiternde Schere zwischen Armut und Reichtum haben die alte Diskussion um Luxus und Überfluss neu befeuert. Nicht bei jedermann war im übrigen Luxus verpönt. „Luxus für alle“ forderten die Mitglieder der Pariser Kommune vor über 150 Jahren. Dass der florierende Handel und die Nachfrage nach Luxusgütern auch dem Wohlstand derer nutzen können, die sie produzieren, diskutieren seit dem 18. Jahrhundert Philosophen, Ökonomen und Soziologe, darunter besagter Voltaire. Ohnehin sind Überfluss und Luxus keine objektiven Größen. Was der Einzelne dafür hält, ist subjektiv und hängt von Zeit- und Lebensverhältnissen ab. Was heute zum Standard eines Haushaltes gehört, ein kompletter Satz Weingläser, galt noch zu Goethes Zeiten als ein nur für wenige erschwinglicher Luxus, den sich der Weinliebhaber aus Weimar selbstredend leistete. Heutzutage mag die Tasche von Prada für die Kassiererin an der Supermarktkasse ein unerreichbarer, vielleicht erträumter Luxus sein, für ihre wohlhabende Trägerin dagegen alltägliche Normalität. Im Wort Luxus stecken Abgedrehtheit und Abweichung vom Normalen. Und eben diese Fähigkeit, uns wenigstens für eine Weile, und seien es nur die paar Stunden eines außergewöhnlichen Konzert- oder Theaterbesuchs, von der Not der kargen Notwendigkeit zu befreien, machen Überfluss und Luxus zum existentiellen Bedürfnis. „Ich kann im Notfall auf das Nötigste verzichten, niemals aber auf den Überfluss“, resümierte der kluge Spötter Oscar Wilde. Recht hat er. Ein wenig Überfluss und Luxus setzen dem grauen Alltag Lichter auf und helfen die Schlaglöcher des Lebens abzufedern. Und wer möchte nicht im Überfluss des Gefühls von Zeit zu Zeit so ganz außer sich geraten und im Glückstaumel das alltägliche Pflichtprogramm vergessen. Weihnachten ist nah, die Zeit, in der wie im Märchen das Wünschen noch helfen soll, so wie damals bei Clara. Das nicht unbedingt Notwendige, aber heimlich Ersehnte zum beglückenden Ereignis werden zu lassen, gehört zu den Basics der Kunst des Schenkens. „Sagst du, du bist überrascht, sagst du, genau das hast du dir gewünscht?“, fragt aufgeregt Pu der Bär im gleichnamigen Klassiker von A. A. Milne in der schönsten Widmung, die je einem Kinderbuch vorangestellt wurde.
Eva-Maria Reuther