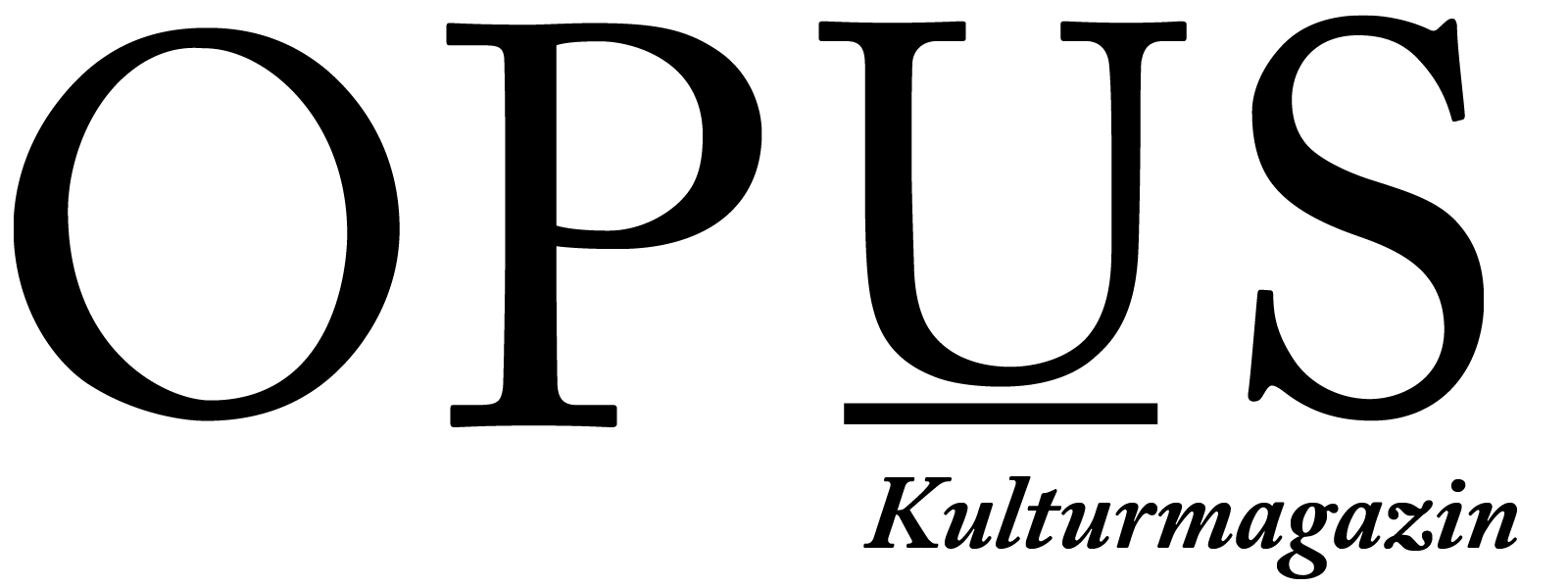Elisabeth Leonskaja © Foto: Marco Broggreve
Es war ein Heimspiel für den Finnen Pietari Inkinen, den Chefdirigenten der Deutschen Radio Philharmonie mit seinem nordischen Programm mit Werken von Jean Sibelius und Edward Grieg. Aber Inkinen setzte durchgehend eigene Akzente, ließ sich nicht auf einen sogenannten‚ allgemeingültigen nordischen Ton ein, sondern setzte seine Interpretationen einerseits historisch an, reflektierte sie in Bezug auf moderne Klangerfahrungen und ließ sich von der Textur und der Grammatik der Stücke auf eigene Gefilde leiten. Er gab immer eher etwas Gas, als dass er sich auf einen gedämpften Ton einließ, er musizierte Bläsersätze mit großer Lust am Klang, manchmal gar etwas hymnisch.
Begonnen hatte das Konzert mit den „Okeaniden“ von Sibelius, einer vom Meer abgelauschten Tondichtung, die von der ruhigen Wellenbewegung bis ins aufgewühlte Meer ging, und die in Inkinens Umsetzung des dreifachen Fortes fast den Charakter eines Tsunami bekam. Für das umwerfende Klavierkonzert von Grieg, ein Hochzeitsgeschenk an seine Frau, hatte Inkinen Elisabeth Leonskaja eingeladen, die Pianistin, die zur Zeit wohl eine der überzeugendsten Interpreten dieses Konzerts ist. Sie spielt die leisen Stellen lyrisch und doch bestimmt, die Attacken und die schweren Klänge werden deutlich betont, kommen aber nie ungezähmt. Leonskaja erzählte eine Geschichte mit diesem Werk, das von der Ausgelassenheit jugendlicher Freude bis zur Innigkeit und zur großen Zuneigung ein Bild eines glücklichen Menschen zeichnet. Technisch perfekt hat sie natürlich gespielt und gezeigt, wie sehr dieses Konzert im Zentrum ihres Repertoires steht. Nicht immer war das Orchester auf ihrer Auffassungshöhe, das Miteinander klappte nicht immer ganz reibungslos. Vielleicht hatte Inkinen auch zu viel Respekt vor dieser Hohepriesterin des Klaviers.
Der zweite Teil war ein reines Wohlfühlprogramm mit den zwei Peer Gynt Suiten von Grieg, dessen spielerische Momente Inkinen wunderbar in Szene setzen konnte, indem er dem breit Tänzerischen seinen Lauf ließ und den Trollen quer durch das Orchester zu ihrem unbeholfenen Tanz verhalf. Bei Ases Tod fand er ein Pianissimo, das letztlich fast nur noch wie eine Ahnung im Raum stand. Das war weit mehr als Unterhaltung. Dieser Peer Gynt fand seinen Weg aus dem 19. Jahrhundert in unsere Gegenwart und hatte mit Inkinen etwas Besonderes zu sagen.
Friedrich Spangemacher