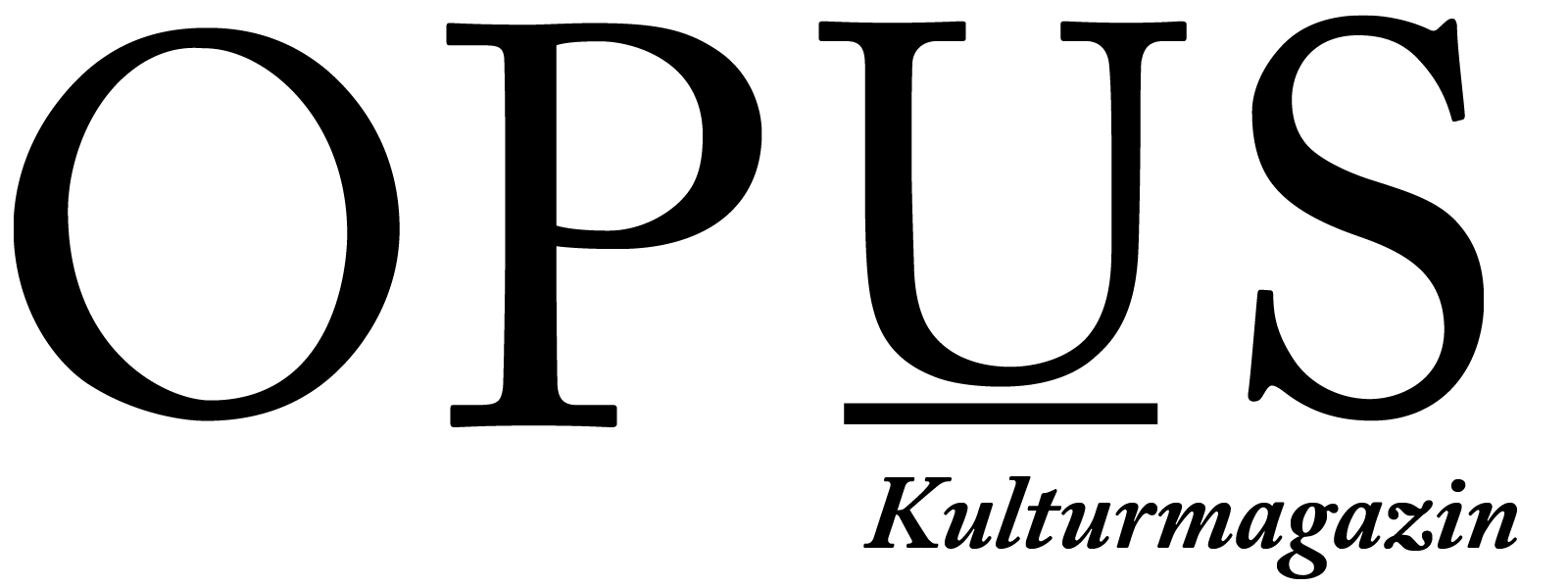Titelfoto: mittig: Paul Gay (Œdipe) © Bregenzer Festspiele / Daniel Ammann
Von Christine Magin
Bregenzer Festspiele: Andreas Kriegenburg inszeniert George Enescus Oper Oedipe
Ein schönes schauriges Erlebnis
Einen gewaltigen Bilderbogen mit ausgeprägter Farbdramaturgie und starker Körpersprache hat Regisseur Andreas Kriegenburg mit Enescus Oedipe in Bregenz inszeniert. Drei Stunden dauert die tragische Oper in vier Akten und sechs Bildern, eine Zeit, die allerdings im Flug vergeht. Weil die Handschrift des Regisseurs gewaltig und einfühlsam ist. „Warum passiert mir das? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Oper, deren Protagonist Oedipe tief in einen Strudel des Schicksals gerissen wird. Dabei beginnt die Oper freudig. Verspielt und fröhlich huldigt das Volk König Laios zur Geburt seines Sohnes Oedipe, den er der Prophetie zufolge nicht hätte zeugen dürfen. Die Thebanerinnen tanzen mit wehenden Kleidern, die alle Farbnuancen eines Feuers bieten. Wie züngelnde Flammen wirken die bewegten Stoffe, doch sogar echtes Feuer brennt auf der Bühne – in einer Feuerschale und mit Fackeln.
Ästhetisch ist die Inszenierung fantastisch, wird die Handlung farblich den vier Elementen zugeordnet, die als Feuer, Wasser, Asche und Holz daherkommen. Die Verbannung ist bei Kriegenburg blau, denn im Grunde ist der Königssohn abgetaucht ohne es zu wissen. Die Bühne wird dominiert von einer weißen Bretterwand mit riesiger Pforte, vor der eine überdimensional lange Bank steht. Wie in einem Wartesaal. In diesem Ambiente wächst Oedipe in blauem Gewand auf – bis sich sein Schicksal erfüllt und er seinen Vater erschlägt. Bühnenbildner Harald B. Thor und Dramaturg Florian Amort sind arbeiten hier Hand in Hand.

Das wohl kontrastreichste Bild ist die Inszenierung der Sphinx. Das Licht ist eisig kalt, dass es einem fast fröstelt. Auf einem Podest mit Rollen wird sie von Sklaven in einem Nebelmeer auf die Bühne gezogen. Nicht einmal ihre überdimensional riesigen Flügel kann sie selber bewegen, die werden „bedient“ von den Sklaven. Grandios wie absurd. Die Sphinx ist inszeniert als schwebe sie in den Wolken, doch fliegen kann sie nicht. „Die Zukunft wird dir sagen, ob die Sphinx sterbend ihre Niederlage beweint oder über ihren Sieg lacht“, singt sie. Ein Indiz gibt der Regisseur, denn er inszeniert sie nicht löwenstark, sondern bleich, ohne Haare und teils als Skelett. Das bitter-faszinierende an der Ödipus-Geschichte sei die Frage, ob es überhaupt eine Chance gibt, dem eigenen Schicksal zu entkommen, oder ob man sehenden Auges in die Katastrophe renne, sagt Kriegenburg.
Diese Geschichte kann man heutzutage so gar nicht mehr erzählen, leben wir in einer Zeit, in der jeder sein eigenes Schicksal in die Hand nimmt. Vielleicht hat das bei der Uraufführung am 13. März 1936 in der Pariser Opéra Garnier noch funktioniert. Das zentrale Thema des Stücks ist im Grunde, dass Frieden nur gepaart mit Wahrheit möglich ist.
Die Vorstellung am Montag ist ergreifend und schön. Kaum fällt der Vorhang, beginnt ein tosender, ergreifender Applaus und als die Schauspieler sich einzeln präsentieren, gehen Begeisterungswogen durch die Reihen. Besonders punkten Ante Jerkunica als Tirésias, der international als einer der gefragtesten Bässe gilt, und die finnisch-spanische Sopranistin Iris Candelaria in der Rolle der Antigone. Der Applaus geht schließlich in stehende Ovationen über, als der französische Bassbariton Paul Gay auf der Bühne erscheint, der den Oedipe in grandioser Weise verkörpert. Spätestens als Dirigent Lukás Vasilek auf die Bühne kommt, springen die letzten aus den Sesseln. Auch dass in französisch gesungen wird und das Publikum die deutsche und englische Übersetzung als „Übertitel“ verfolgt, schränkt die Begeisterung nicht ein. Das Ergebnis: eine gelungene Inszenierung, ein dankbares Publikum und eine glückliche künstlerische Leiterin. Denn Lilli Paasikivi, die seit 2025 die Festspiele leitet, war auch bei der zweiten Vorstellung wieder mit im Saal.